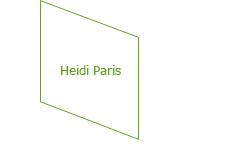Jahresring
Je nach Standpunkt der Betrachtung erscheint die eigene Figur in einem anderen Licht. Um diese Erfahrung machen zu können, muß man sich nicht nur dem Blick anderer Personen aussetzen, sondern unterschiedliche Personen ersteinmal kennen und gerade auch wegen Ihrer Andersheit schätzen können.
Das Gespräch mit Nils Röller war sehr sprunghaft verlaufen. Es ging um die Herausgabe der Texte von Cacciari und um die eventuelle Veröffentlichung von Perniola’s De Sentire. Und zu schnelllebig war die Zeit, um handschriftliche Aufzeichnungen darüber machen zu können. Sie hatte den Standpunkt der Betrachtung eingenommen, die man als “Blick zurück in die Gegenwart” bezeichnen kann. Der Betrachter als eine Art Zeitgenosse verstanden, als Zeitbegleiter im Zeitalter der Wandlung.
Der Umstieg von Indien und Japan auf das Grau-in‑Grau mit den stummen Gesichtern in Deutschland war schwer. Danach hatte sie eine Woche lang nur Zahlen gesehen: Inventuren, Bilanzen, Abrechnungen. Bereits nach einer weiteren Woche war der erste Text für die Frühjahrsproduktion druckreif. Danach hatte sie eine Woche lang wieder Kontakte aufgenommen und Treffen mit Bekannten und Freunden organisiert. Daraus war sie enttäuscht hervorgegangen. Niemand hatte in der Zwischenzeit etwas Nennenswertes unternommen oder war anderweitig hochmotiviert. Vielleicht mußte sie auch schleunigst ihren Bekanntenkreis ändern.
Noch während sie in diesem Debakel der Unentschiedenheit hing, hatte sie den Verlag einer Gruppe von Berliner Komparatistikstudenten zu präsentieren. Die durch diese Rolle aufgezwungene Selbstdistanz hatte eine Wandlung eingeleitet. Wenn eine allgemeine Orientierungslosigkeit zu verzeichnen war, andererseits die Probleme bis vor die eigene Haustür schwappten, dann wollte sie völlig illusionslos Hand anlegen, will sagen ins Geschehen bzw. Nicht‑Geschehen eingreifen.
Es war bereits Mitte Februar überschritten. Die Tage wurden wieder länger, das Licht heller, und hier und da hörte sie schon wieder Vogelgezwitscher. Kaspar König war nach Berlin gekommen, um bei einer öffentlichen Pressekonferenz sein Gutachten über den Zustand der Bildenden Kunst in Berlin zu präsentieren. Es handelte sich dabei um einen Senatsauftrag, der folglich nur staatliche Einrichtungen berücksichtigte: Museen, Akademien, Fördergelder. Ein bißchen enttäuscht stellten sie fest, daß Merve als “Kulturinstitution” unter solchen Aspekten unerwähnt bleiben mußte. Trotzdem waren sie erfreut, den drahtigen Mann aus Frankfurt wiederzutreffen, der ihnen nicht ungesonnen war.
Der Einstunden‑Jet nach Stuttgart zur Akademie Schloß Solitude verlagerte den Blick auf das Leben in die Vogelperspektive: wie müßig, alles Tun und Rasten unter Abermillionen Lebewesen! Gelandet stellte sich ihr die neue Aufgabe der Jurorin in Sachen Design. Sie zeigte sich in aller Unsicherheit und Blödigkeit, einfach weil sie nicht glauben wollte, daß so viel Geld ausgegeben wird [für etwas] ohne ein Geheimnis.
Jedesmal wenn sie dort war, erlebte sie einen Koller und meinte, es kam von den Nahrungsmitteln, die sie zu sich nahm: dem Rotwein, dem Mineralwasser, dem Essen … Sie staunte, wie sehr die Menschen Namen und Fakten beherrschten und offenbar wußten, wovon sie sprachen und was sie wollten. Verwirrt kehrte sie zurück und mußte noch am Morgen der frühen Ankunft in Berlin auf dem Türkenmarkt einkaufen. Da sah sie die zwei leeren Pappkartons von spanischen Apfelsinen mit der gelb/schwarzen Aufschrift “heidi” direkt am Markteingang gut sichtbar stehen. Dazu kam, daß ihr Wagen auf dem Hinterhof eine Reifenpanne aufwies. Einmal verwirrt, zweimal verwirrt.
Was mußte sie tun, damit der Spuk vorbei war oder endlich sein wahres Gesicht zeigte?
Der Alltag nahm sie gefangen, und es bedrückte sie die ungeklärte Krankheit ihres Compagnons. Er hatte Schmerzen, also Krankheits‑Symptome, aber die Ärzte konnten keinen Befund feststellen.
Sie verfügte über keine Strategien für die Zukunft, obwohl sie an nichts anderes dachte als an die Zukunft.
Einige Abende unter Freunden hatte sie bereichert. Das Festliche und Warmherzige privater Atmosphäre regte die Gespräche an. Diese waren persönlicher, offenherziger, und sie hatte das Gefühl erfahren, eine Person zu sein, die andere aus unerfindlichen Gründen schätzen.
Es war Anfang März. Die Tage waren länger geworden, das Tageslicht heller, der Frost war vorbei. Ruhig und stetig arbeitete sie am Frühjahrsprogramm. Dazwischen festliche Abende mit vielen Veranstaltungen in der Stadt. Es gab eigentlich keine nennenswerten Probleme, doch gerade deswegen stellte sich ihr immer stärker die Frage, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollte. Wozu und womit?
Go on, sagte der schüchterne junge Amerikaner, der am 28. März zu Besuch bei uns saß. Und er hatte es ernst gemeint. Also über das hinausgehen, was der Zustand der Dinge war, the matter of facts. Er hatte es gesagt wie eine Ermutigung, als wüßte er, wovon er sprach. Sie sprachen über einen Medizinerkongreß und über das Phänomen, daß immer mehr Symptome auftraten, aber keine feststellbare Krankheit. Und er sprach davon, daß die Elektrifizierung in direktem Zusammenhang stünde mit der zunehmenden Nervosität der Menschen. Noch vormittags hatten sie über die Gleichzeitigkeit in der Musik gesprochen, zusammen mit dem Komponisten Wolfgang Schweinitz, der der Weimarer Musikhochschule ein neues Lehrprogramm erarbeiten sollte. Und dann wieder sprachen sie über die Polyeder oder das Oktogon bei Dürer’s Melancholie in neuartiger Stereogramm‑Technik. Es gab so viele Anschlußstellen für künftige Arbeitsfelder, sie mußte nur offen dafür sein.
Und immer wieder spannte sich der große atmosphärische Raum über ihr, und sie sah die Weite der Ewigkeiten über den Winzigkeiten. Und sie hörte den Hall von Schall und Rausch. Und sie sah die Puszta und die verbrannten Sonnenblumenfelder à la van Gogh wieder. Sie mußte diese Weite des Raumes wiedergewinnen, denn wie schrieb neulich ein Freund:
“Je weiter wir ein Beziehungsgeflecht zum Horizont hin überschauen, desto mehr spielt sich unsere eigene Kondition in den Mittelpunkt des Stückes.”
Meinte er wirklich Kondition?
Sie hatte gründlich den Faden verloren, und eine Weile lang hatte sie auf den Ritter gehofft, der sie herauszog aus der Misere. Nun mußte sie gewahr werden, daß sie sich am eigenen Schopfe herausziehen mußte. Aber wie?
Ob das Substrat an menschlicher Regung noch ausreichte, um Formen zu schaffen, die sich auf den Gipfeln der Höhe die Bälle zuwarfen?
Sie war zuviel mit sich beschäftigt. ‑ Wer war der junge Mann aus USA, der den Black‑Panther‑Band von Foreign Agent überbrachte? Er hatte eine europäische Stimme, eine zurückhaltende Art, Kleidung wie von der Army in civil, und das Exemplar war von den “Active Foreign Agents” und enthielt ein FBI‑File.
Er hatte ein Free‑Ticket to Berlin, weil seine Eltern zu einem internationalen Kardiogramm‑Computer‑Kongress nach Berlin gekommen waren. Ihn interessierte, als ich ihm davon erzählte, ein Band über Medizin, über Symptome ohne wirklich nachweisbare Krankheiten, über die zunehmende Nervosität bei zunehmender Elektronifizierung, über die nicht‑feststellbare einfache Todesursache heutzutage. Er war es, der ihr mit Bestimmtheit sagte: “go on”.
Sie interessierte, warum der Freund mit den Stereogramm‑Zeichnungen und Dürer’s “Melancholie” im Zentrum von Berlin, dem Potsdamer Platz, ein Oktogon sah, und wenn man dieses wegnahm, ein Hafenbecken? Was sollte wem hier angeliefert werden???
Endlich war es hell geworden. Weit geöffnet waren alle Fenster des Verlages, den Duft der milden Luft hereinzulassen. Die Zeitumstellung fand nicht nach dem offiziellen Kalenderfrühlingsbeginn statt, sondern am 26. März, dem Pessach‑Fest.
Sie hatte einen wichtigen Arbeitsabschnitt beendet, hatte für die kommenden Festtage vorgesorgt, das Wetter war schön, sie hatte das Fahrrad geölt ‑ und fort war sie. Der erste Frühlingsausritt auf dem Fahrrad nach Zehlendorf in den Schrebergarten einer Freundin hat sie erfrischt und beseelt. Schon hat sie Samen und Knollen und Pflanzen gekauft, um ein Rondell im Grünen zu kultivieren. Die Haut war von der Sonne gebräunt und von der frischen Luft geglättet, der ganze Körper war von der Bewegung gut durchblutet wieder spürbar geworden. Sie hatte sich in zwei Stunden regeneriert. Und sie hatte es geschafft, sich allein loszureißen von dem Arbeitsalltag. Staunend schaute sie die Menschen im Konsumgetriebe. Sie hatte die Fähigkeit zum Abschalten errungen. Und sie war froh darüber.
Müßiggang. Spazierengehen. Blumen pflücken. Dem Abendhimmel zuschauen. Den Regen im Gesicht spüren. Die Uhr ticken hören. Ostern Briefe schreiben. Das helle Licht am Tage versetzte sie in eine leichte Stimmung. Alles hellte sich auf. Die düsteren Gedanken verflogen. Alles wollte herausgeputzt sein. Sie kannte das Licht aus Skandinavien und sie kannte das Licht der Adria. Schön schien ihr auch das Licht von Tunesien. Sie fühlte sich ungebunden. Keiner Last unterworfen, außer der Sorge um das täglich Brot. Für sie gab es eigentlich keine freie Zeit. Überall lagen Projekte brach.
Sie entwickelte gerade eine neue Cover‑Konzeption aus der alten Raute in Stereo‑Technik. Dazu brauchte sie die Mithilfe ihres alten Graphikers Stankowski und bei der technischen Umsetzung die Mithilfe von Folke Hanfeld.
Sie hatte die ganzen Osterfeiertage Briefe geschrieben und auf diese Weise wieder Kontakt aufgenommen mit verschiedenen Ländern, Mentalitäten, Fragestellungen; und es hatte ihr gutgetan. Sie hatte sich auf diese Weise wieder ihres Beziehungsreichtum vergewissert, den sie so eigentlich gar nicht ausschöpfte. In den Zeiten der Hektik und action gelang es ihr nie zu schreiben. Dann riß sie der Handlungsstrom hinweg. Ein zwei Stunden Besinnung halfen dann die Kräfte regenerieren, aber erst das leere Feld von 4 Tagen auferlegtem Müßiggang half, an die Wurzeln der Kreation heranzureichen. Dann lebte sie auf. Ihr Äußeres nahm dann die Gestalt einer Ateliersfrau an, die es gewohnt ist, rund um die Uhr im Rausch schaffend zu sein. Ganz ohne Rausch ging es wahrlich nicht.
Meistens häuften sich die Besuche. Dieser Tage kamen die beiden Vertreter aus der Schweiz, zusammen mit Werner, der uns als seine Erben gerne sähe. Gleichzeitig hatte sie mit Folke [Hanfeld] den Cover-Entwurf zu besprechen, am nächsten Tag rief Daniel [Charles] an, Christophe [Charles] ist aus Japan angekommen, und aus Hamburg verkündete Agnes [Handwerk] die Beendigung ihres Foucault‑Projekts. Hannes [Böhringer] kam, um seinen Text zu besprechen, und Isshu schrieb seinen Dankesbrief aus Japan. Hermes’ Wege kreuzten sich. Sogar die Mutter eines lang erwarteten Freundes rief an. Komisch.
Mit dem dänischen Computer‑Freak aus Frankfurt, der über die Ostertage in ihrer Wohnung wohnte, hatte sie ein paar kleine Fortschritte mit ihrem Modem gemacht. Nun war sie Mitglied beim Internet und hoffte endlich via e‑mail neue Wege beschreiten zu können. Derweil hatte ihr Compagnon Autoren und Freunde in Paris besucht. Und es waren wieder neue Buchprojekte angeleiert worden: ein Daniel Charles-Band, ein Guattari‑Band, ein Böhringer‑Band, evtl. Manny Faber über Film, evtl. Gespräche mit Frank Gehry, vielleicht auch William James über Blindheit mit einem Vorwort von Luhmann, Baecker über Post‑heroisches Management, über The White Cube (Galerien‑Funktion in den 70er Jahren), Gracián-Symposion‑Stuttgart etc.
Durch eine verschleppte Erkältung hatte sie einen Weisheitszahn eingebüßt. Mit ein bißchen Hilfe zur Selbsthilfe hatte sie per Rotlicht‑Bestrahlung den Eiterherd im Kopf gelöst.
Die Lektüre‑Gruppe zu Tausend Plateaus fand mit wöchentlicher Regelmäßigkeit statt, und die Diskussionen in dem kleinen Kreis waren rege und abwechslungsreich. Sie freute sich auf diese Abende, auf die Gespräche und die daraus entwachsenen neuen Bekanntschaften mit Daniel [Tyradellis], Andreas [Hiepko], Sebastian [Weber], Nils [Röller], Christian [Weber], Nadja [?], Holger [Porath], Franz [Rodenkirchen].
Ein erster gemeinsamer Ausritt auf dem Fahrrad mit ihrem Compagnon hatte sie zum Potsdamer‑Platz geführt, dem rätselhaften künftigen Zentrum Berlins. Dabei war ihr Freund vom Rad gefallen, aber mit Schrammen und einem Schreck davon gekommen. Trotzdem hatte der frische Wind sie aufgemuntert. Ihr war ihre erste FischWeinSoße gelungen. Darauf war sie stolz.
Es gibt Momente, die sind in sich erfüllt. Ein sonniger Sonntagmorgen, nach einer Dusche, bei einem Glas Tee und einer Zigarette allein in den weiten lichten Räumen des Verlages bei guter Musik in den Tag hinein leben.
Sie hatten die Frühjahrsproduktion herausgebracht. Drei Bücher, die ihr gefielen und die auch bei den Lesern und in der Presse positives Echo gefunden hatten. Danach war ihr Compagnon für zwei Monate auf Reisen gegangen. Sein Fernweh war stärker als der eigene Schaffensdrang. Zuerst hatte sie sich vor der langen Zeit des Alleinseins gefürchtet. Aber schon nach dem ersten Tag wirkte eine aufbrechende Kraft in ihr, die endlich dem Schaffen freien Lauf lassen konnte. Zunächst ein Aufräumen, dann ein Wegarbeiten des Liegengebliebenen, dann spielerische Aufnahme ungewohnter Tätigkeiten, dann Verlangsamung des Tempos, schließlich kreativ schöpferisches Tun.
Jus[tus Zielinski] war zurückgekehrt, hatte sich den Wagen ausgeliehen, während sie einen kleinen Ausflug nach Stuttgart zur Akademie Schloß Solitude unternommen hatte, die neuen Stipendiaten mit ihren jeweiligen Projekten kennenzulernen. Als sie zurückkam, hatte Jus ein neues Verlagsschloß angebracht, nachdem man versucht hatte einzubrechen. Bei der Gelegenheit waren sie ein wenig ins Gespräch gekommen. Hauptsächlich über indische Weisheiten und den indischen Tanz Shiva, die Gestalt der Zerstörung, aber auch des Neubeginns. Die Gestalt der Wandlung.
Das Telefonat von Jus hatte die Sonntagsstimmung unterbrochen. ‑ Es war lange her, daß sie mal allein miteinander gesprochen hatten. Eine fast neue Erfahrung. Die Tonbandkassette, die er ihr überspielt hatte, war liebevoll gemacht. Schon kurz darauf gab es wieder einen Grund zur Zusammenkunft. Er hatte Zeit mitgebracht und machte mit ihr einen kleinen Ausflug im Auto, zum Tränenpalast mit brasilianischer Musik, wo er erstmal die Beifahrerfensterscheibe wieder in die Angeln hob, besuchten dann Karl‑Heinz [ Barck], der leider nicht zu Hause war, dann in einem Bogen durch Ostberlin zur “Markthalle”, dem neuen Weltrestaurant. Nachdem er ihr einen Porto spendiert hatte und sie eine Weile geplaudert hatten, holte er sich eine Zeitung an den Tisch, wogegen sie protestierte. Ein Bekannter von ihm setzte sich schließlich an ihren Tisch, und es ging ein Geplänkel über den Tisch über die “Liaisons Dangereux”. Sie drängte schließlich zur Heimfahrt. Fröhlich kehrte sie heim.
Zwei Tage Zugausflug nach Frankfurt/M.. Ihre Repräsentationstätigkeit war ziemlich baden gegangen. Die Herren von der Kommunikationsabteilung waren einfach unverschämt dreist. Nachdem sie alle connections zu ihrem Autor aufgebaut hatten, ließen sie sie im Regen stehen, ohne Hotelreservierung etc. Erbost war sie gleich am nächsten Tag wieder abgereist und hatte noch einen Schlenker über Braunschweig genommen, wo die Eltern in Umzugsvorbereitungen steckten. Sie konnte sich in freundlicher Atmosphäre etwas beruhigen und fuhr am nächsten Tag erfrischt per Bahn nach Berlin zurück.
Die Erledigungen nahmen sie nur halb in Anspruch. Wichtiger war, welche Musik spielte. Es war ein schöner Frühling. Milde und warm. Sie konnte endlich genießen.
Erst war sie enttäuscht, als sie zurückkam und zum verabredeten Zeitpunkt bei Jus niemand am Telefon abnahm. Dann hatte sie sich besonnen, und als sie später zurückkam, stand das Auto vor der Tür, gewaschen und mit Post, und sogar mit einem Buch für sie und einem Fächer auf dem Rücksitz. Liebevoll. Warum war sie immer so mißtrauisch und glaubte nicht, daß er es gut meinte?
Kaum war sie zu Hause und hatte die Post gelesen, da rief er auch schon an, und winkte mit einer Einladung zum Spargelessen. In Minuten bin ich in seinem Paradies. Wenige Worte, ein Essen, Musik, Bücher, Bilder, Kunstwerke, Souvenirs. Er zeigt mir viel, gibt mir viel, still, ruhig, ohne Aufregung. Ich bin nicht gerade verklemmt, aber ich bin auch nicht frei. Vieles, das ich mir ausleihen möchte. Er ist geduldig. Es ist freundschaftlich.
Nach dem Spargelessen mit dem hübschen Wiesenblumenstrauß und einem Kaffee fahren wir mit dem Fahrrad ins Ex+Pop, die alte Stammkneipe. Nachdem er mir die Tür aufgehalten hat, bin ich verschwunden im hintersten Eck der Kneipe und halte einen Schwatz mit Jochen, dem Kneipier. Ich kann mich mit Jus in der Öffentlichkeit nicht verhalten. Bin ich ihm nahe, geht er weg. Bin ich fern, geht es
auch nicht zusammen. Trotzdem bin ich selig, wie lieb er sich um mich kümmert, wenn ich allein bin.
Und dann entstehen die entsetzlichen Löcher, in denen ich die Zeit totschlagen muß. Immernoch warten. Wie dumm. Musik ist dann der Freund der Einsamkeit.
Sie hatte den Text von Jabès über die Friedhofsschändung von Carpentras korrigiert und fertig gesetzt, damit er im Herbst in Düsseldorf als Sonderdruck erscheinen konnte.
Ein Abend mit Cathy Lara aus San Francisco, einer jungen Germanistin von der Berkeley‑University. Sehr frisch, sehr belesen, sehr unamerikanisch. Die Mutter ist Deutsche, das merkt man sogar an ihrer Stimme. Wir haben uns um Mitternacht verabredet, sind ins Ex+Pop gegangen, dann ins Kumpelnest und schließlich in den Strudel. Wir haben viel geredet und ich habe viel getrunken. Aber ausgelassen zu sein, ist auch mal nötig.
Peter brauchte von Jus Hotel‑Tips für Bangkok. Wieder ein Anlaß für ein Treffen. Sie waren beide frech zueinander, scherzten ausgelassen. Sie hatte seine schöne blaue Hose bewundert und seine klobigen Schuhe moniert. Sie schenkte ihm eine Tonbandkassette, worum er als Cover liebevoll ein Foto legte, das sie aus Polen mitgebracht hatte. Er übersetzte und erläuterte ihr einen schwierigen Text über die Unendlichkeit von Spencer Brown: “The excursion to infinity undertaken to produce it has denied us our former access to a complete knowledge of where we are in the form.”
Daraufhin schenkte sie ihm ein Buch aus dem Verlag, über KybernEthik. Sie wollte ihm das Fotoalbum von Indien und Japan zeigen, aber schon die ersten beiden Postkarten fanden seine Ablehnung. Er trank ein Glas Rotwein, sie gab ihm etwas Käse dazu. Dann fuhren sie noch ein Stündchen in der Gegend herum, Freunde besuchen. Zur Abendbrotzeit verabschiedeten sie sich voneinander. Er fuhr mit dem Rad im Regen heim mit einem Schmunzeln zum Abschied.
An ihrem Geburtstag rief die Family an, Peter meldete sich aus Las Vegas, der Stadt der Spielhölle. Sie hatte Sekt gekauft für den Fall der Fälle. Aber außer ihrer Erwartungshaltung war nichts Nennenswertes zu erwarten. Trotzdem war sie aufgeräumt und guter Stimmung. Es war ein sonniger Tag und sie spielte Musik. Dann kam ein Freund zufällig hereingeschneit, um sein neues Projekt für die Ausstellung vorzulegen. Sie war begeistert. Und es entspann sich ein langes Gespräch um Art der Buches, über die Art des Openings, und sie hatten gemeinsam eine neue Raumidee konzipiert und hatten dabei einen neuen Beruf für ihn erfunden, den Bühnenbildner. Es war so anregend, daß sie noch Stunden danach angefüllt davon war. Er ließ sie sein, wie sie war; es war aber auch nicht ohne Erotik. Eine Mischung, die sie noch nie erfahren hatte. “Einsame Frauen sind anstrengend” hatte sie ihm entschuldigend nachgerufen. Und er fragte zurück “Frauen im Plural?”.
Sie liebte das Alleinsein. Eine gewisse Selbstgenügsamkeit, die produktiv sich auswirkte. Sie lernte Enthaltsamkeit, Askese, als Lösung von den Banden der Abhängigkeit. Er hatte ihr sehr viel beizubringen. Er vermochte, daß sie ruhig und glücklich an Ort und Stelle umherwanderte. Eine Art Hospitalismus des Nomaden, der noch unbewußt seinen Wandertrieb auslebte.
Sie lebte in den Tag hinein und freute sich, dass die Wünsche wie zarte Pflänzchen allmählich wieder aufblühten. Hier und da ein kleiner Wunsch. Wie beglückend. Ein herrlicher Frühling. Endlich im Einklang mit der Jahreszeit und mit dem eigenen Lebensalter. Wie viele Umwege und Jahre hatte das gebraucht! Endlich. Sie spürte eine gewisse Reife, eine gewisse Souveränität. Sie kannte die Flugpläne, sie arbeitete mit e‑mail, sie fühlte sich auf der Höhe ihrer Zeit ‑ sei sie nun Barock oder Renaissance.
Justus’ Charme hatte sie wieder einmal verzaubert und das Warten war unerträglich. Sie mußte sich davon lösen.
Jus war die Formvollendung das Wichtigste. Sie war glücklich mit ihm. Nicht sehr verwöhnt. Aber sie war ja auch bescheiden. Es hatte auch keinen Zweck etwas zu fordern, was er oder sie nicht zu leisten vermochten. Obwohl sie die Kraft dazu verspürte.
Endlich war es ihr gelungen, umzuschalten und sich wieder der Welt zuzuwenden. Cathy Lara aus San Francisco hatte sie zu einem Film‑Diskussionsabend im Berliner Ensemble eingeladen. Noch als sie vor dem Eingang standen, trafen sie Harun Farocki, den Filmregisseur, und dann Dirk Baecker mit Carena und in der Theaterkantine Friedrich Kittler und Heiner Müller, zu dem wir uns an den Tisch setzten. Er kümmerte sich rührend um sie. Gab ihr im Theater einen schönen Platz und setzte sich persönlich dazu. ‑ Bei der Diskussion ging sie dann, als die Männer jovial von Monarchien, Revolutionen und die Politiker im allgemeinen redeten.
Die TausendPlateausLektüreGruppe war ein richtiges Glück. Nils hatte die richtigen Leute gefunden, sie waren interessiert, wach, engagiert, lachten gern und hatten auch darüber hinaus Interessen. Sie war richtig glücklich darüber. Nach einer ausgelassenen Sitzung fand sie am nächsten Morgen in ihrer Handtasche die Visitenkarte eines der jungen Männer, dem sie fröhlich im Beisein aller einen Kuß auf die Wange gedrückt hatte. Außer seinem Namen und einem anzüglichen Bild auf der Rückseite fand sich die ominöse Bezeichnung: Museum für obsolete Unterhaltungselektronik.
Walter Seitter war aus Wien gekommen zum Vortrag im Podewil. Glasmeier hatte ihn eingeladen. Sein Vortrag war aber kryptisch und zu selbstbezüglich. Schade. Er hatte eine richtige Berliner Fan‑Gemeinde um sich geschart.
Abendessen mit Hanns Zischler und Regina Poly im neu eröffneten Restaurant Dschungel. Die Besitzerin war hocherfreut über unseren Besuch. Die sprunghaften Gespräche drehten sich um japanische Gärten, Architektur in London und Madrid, Frank Gehry, Hadid, Velazquez und Martin Denny. Sie sind beide sehr feinfühlig, warmherzig und humorvoll. Ganz selig schwebte sie heim.
Jus hatte sich wieder einmal das Auto ausgeliehen. Sie hatte ihn ein bißchen kurz angebunden behandelt. Dabei hatte er ihr ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk mitgebracht, ein Buch aus der Serie der Transformationen in Anspielung auf ihr bekundetes Interesse an der Wandlung. Ein Buch über Pluto und die Herrschaft der Unterwelt, wovon er ihr bereits erzählt hatte. Es enthielt ein merkwürdiges Motto:
“ma guarda e passa” ‑ “schau hin und geh vorbei!” [Die Göttliche Komödie, Inferno III, 51 ]
Dann hatte er das Auto gewaschen und sich um nötige Reparaturen gekümmert. Sogar eine neue Musikkassette lag im Wagen. Chinesisches Zheng-Instrument. Er hatte ihr nochmal die Tontechnik zu erklären versucht, aber sie war immer unfähig, die Technik zu begreifen. Er ärgerte sich, daß sie sich dagegen sperrte zu begreifen. Sie ließ ihn abermals darüber reden, bis ihm unterwegs bewußt wurde, daß er ihr immer redete “von dem Saft, der hier raus- und da reingeht”. Er hielt kurz mitten im Satz inne und korrigierte dann seine Wortwahl. Er war einfach ein Schatz.
Wenn die Sonne schien, hatte sie die Fenster weit geöffnet. Einmal verfing sich der Wind in der Ecke und hob das Bild der Toteninsel vom Haken, so daß es herabfiel und die Leinwand einen Riß bekam. Die Weltkugel, die als Gummiballon von der Decke hing, war gleich in den ersten Tagen ihres Alleinseins von der Decke gesegelt und lag hinfort am Boden. Sie hatte keine Anstalten gemacht, sie wieder aufzuhängen, obwohl sie es als schlechtes Omen empfand. Manchmal wanderte sie einfach nur stumm durch den herrlichen lichten großen Raum und atmete die Luft.
Manchmal kam sie sich vor wie das Maskottchen vom irgend so einem Intellektuellen‑Club. Cathy dagegen erschien ihr wie San Francisco die erste Adresse der neuen Generation. Sie ließ ihren Gedanken freien Lauf.
Die geistige Beweglichkeit erwachte wieder. Sie war auch nicht mehr ganz so menschenscheu. Am Abend hatte sie mit Walter Seitter in der Loge im Hebbel‑Theater The Passions von Shelly Hirsch und Barbara Bloom erlebt. Und zum ersten Mal seit langer Zeit genoß sie wieder das Leben.
In ihrer Wohnung lag seit neuestem ein großer asiatischer Seidenteppich. Ein Erbstück von ihrer Großmutter. Sie würde wohl das ganze Zimmer drumherum neu gestalten. Eine schöne Aufgabe.
Der literarische Salon von Hanns Zischler in der Gartenvilla bei Regina Poly war amüsant. Hanns las die ironische Geschichte eines russischen Schriftstellers namens Terz im Verhältnis zu seinem Verleger. Und die ein wenig steife Kaffeegesellschaft scharte sich um ihn. Sie hatte Cathy Lara aus San Francisco dazu mitgenommen. Anschließend waren sie ins Restaurant Storch Essen gegangen und hatten über Heidegger, Avital Ronell, Derrida und Thomas Bernhard gesprochen. Sie war froh, auch einmal mit einer Frau intellektuell einen Austausch gefunden zu haben. Währenddessen müßte ihr Compagnon auf Tahiti eingetroffen sein. Sie hatte länger nichts von ihm gehört und fragte sich, ob das letzte verpatzte Telefonat daran schuld war.
Wozu schrieb sie eigentlich diese Alltäglichkeiten auf? Glaubte sie etwa, daß sie über Belanglosigkeiten hinausgingen? ‑ Sie war in eine Phase der Wandlung eingetreten, der sie bewußt beiwohnte, und die sie nach Kräften selber bewirkte. Es war eine Phase der Reifung. Durch ihren anderen Lebensstil war ihr klargeworden, daß sie unabhängiger von ihrem Compagnon leben und arbeiten wollte.
Sie hatte kurzerhand Jus angerufen und ihn gefragt, ob er Lust hätte, mit ihr zwei Tage nach Madrid zu fahren? Sie würde ihn auch dazu einladen. Er solle es sich überlegen.
Am folgenden Tag kam die Antwort: Nein. Er hätte keine Lust. Für die Länge der Strecke wäre die Zeit zu kurz: 15 Stunden Reisezeit für 1 1/2 Tage Aufenthalt. Was sie denn in Madrid wolle.
‑ Sie wollte sich ein Bild anschauen, ein neues architektonisches Gebäude und sonst rumbummeln und sich ins Café setzen. Vielleicht noch einen Ausflug nach Toledo, das 2 Zugstunden von Madrid entfernt läge. ‑ Naja, dafür müßte man schon einen Tag länger bleiben, und dann könnte man noch einen Abstecher nach Sevilla machen. Dafür müßte man schon eine Woche einplanen. ‑
Eine einwöchige Abwesenheit aus Berlin duldete aber ihre Verlagsarbeit nicht, so lange sie allein war. ‑
“Dann machen wir es eben, wenn Peter wieder da ist”, war seine Antwort. Sie war perplex, aber je länger sie darüber nachdachte, wurde ihr diese Aussicht immer sympathischer. Er müsse demnächst in Paris einem Freund bei der Einrichtung einer Ausstellung helfen, da könne sie doch mitfahren.
‑ Sie hatte jetzt keine Lust auf Paris und als 3. Rad am Wagen schon gar nicht. ‑ Frei nach dem Motto: “Warum in die Ferne schweifen, sieh das Glück liegt doch so nah” einigten sie sich schließlich auf einen Tagesausflug in die grüne Umgebung Berlins. Er wollte Holz im Wald holen, und sie wollte den Ort ihrer Ahnen aufsuchen.
Nachdem der asiatische Seidenteppich eine Umsetzung ihres Bettes in die Zimmerecke erforderlich gemacht hatte, konnte sie nicht mehr schlafen. Sie mußte aufstehen und sich mitten im Zimmer auf dem Teppich ein Nachtlager aufschlagen. Danach konnte sie ruhig einschlafen. Anderntags hatte sie die Möbel allesamt ein wenig zurechtgerückt, und es war ein fast asiatischer leerer Raum entstanden, auf dem sie bei Abenddämmerung und Vogelgezwitscher eine kleine Teezeremonie veranstaltete. Zum grünen Tee in der neuen Tasse bei Kerzenschein und Räucherstäbchen las sie dann Gedichte von Durs Grünbein. Ruhe kehrte ein. Sie schrieb dem Autor einen kurzen Brief, bis der Nachbar mit der Bohrmaschine die Stimmung zerriß.
Sie träumte an der Wirklichkeit vorbei. Sie erträumte sich eine Wirklichkeit, an der sie immer wieder abprallte. Und dann wieder träumte sie willentlich, um der langweiligen Wirklichkeit, der enttäuschenden Wirklichkeit zu entgehen. Diese erträumte Wirklichkeit war schön und spannend. Meistens trat eine ungeheure Verlangsamung ein, die schneller war als alle Hektik. Man sah hin und ging vorbei. Gelassenheit. Dies war ihre Art, die Meditationen einzuleiten. Allmählich fand dann eine Umorientierung statt. Sie beachtete die Sitzhaltung, verbesserte das Licht der Umgebung, suchte sich ein Kissen mitten auf dem leeren Teppich, und wählte die Stunde der Abenddämmerung, wenn die Vögel im Hof ihr Abendlied sangen. Sie schöpfte Kraft aus solchen Stunden. Auch das Alleinsein gab ihr Stärke. Bislang war sie nur gezwungenermaßen allein, hinfort wollte sie sich im Zweifelsfalle dafür entscheiden.
Jus hatte sie versetzt mit dem kleinen Ausflug in die Umgebung Berlins. Ihm war etwas dazwischengekommen, ohne daß er Bescheid gesagt hatte. So war sie zwei Tage lang blöde angebunden gewesen, ohne daß sie mit der Zeit etwas rechtes hatte anfangen können. Schließlich hatte sie sich für diese zwei Tage nichts bestimmtes vorgenommen. Sie war verärgert und beleidigt. Sie beschwerte sich bei ihm. Er konnte eben feste Verabredungen ebensowenig einhalten wie lose.
Die Redaktion an dem Musikband von Daniel Charles ging nur schleppend voran. Es gab keinen Satz, der nicht stilistisch zu verbessern war. Außerdem gab es zuviel andere Ablenkungen. Daniel Charles rief aus München an, wo er einen Vortrag hielt und lieferte noch die fehlenden Fußnoten. Heinz von Foerster rief aus Califonien an und kündigte seinen Festvortrag in Hamburg zum Weltkongreß der Psychiatrie an. Sie mußte dafür sorgen, daß in der Kongreßhalle der Buchhändler auch die entsprechenden Bücher auslegte. Außerdem wollten noch die letzten Korrekturen des Baecker‑Textes über postheroisches Management gemacht sein. Sie liebte ihre abwechslungsreiche Arbeit.
Der Frühling entfaltete sich in seiner ganzen Pracht. Freudestrahlend war sie mit Jus ausgefahren. Er hatte ihr Räucherstäbchen mitgebracht, trug ein leuchtend rotes Hemd und schenkte ihr ein lindgrünes Feuerzeug. Sie schlenderten in Sanssouci über die frisch gemähten Wiesen, plauderten dabei über Madrid und Paris, Indien und die Sterne. Er erzählte ihr von einem Prager Klostergefängnis, das sie jetzt zu einem pinkfarbenen Hotel umfunktioniert hatten. In einem großen Bogen fuhren sie über die Schnellstraße via Teltow nach Berlin zurück. Der Fahrtwind kühlte und ihre Arme berührten sich zart. ‑ Auf der Suche nach einem bestimmten Holz hatten sie einen Abstecher zu ihrer Schwester gemacht. Ihn beeindruckte die große Villa mit dem gepflegten Garten. Sie fuhren nach Kreuzberg, und er zeigte ihr ein neues Restaurant im österreichischen Stil. Beim Essen sprachen sie über Weine, deutsche Redewendungen und Beiwörter, und über Küsse und Karies. Am Schluß hatte sie sich bedankt und er hatte den Dank erwidert.
- FotografIn ?
“Das 2. Sein”, die Ausstellung von Martin Kippenberger im Potsdamer Kunstspeicher hatte sie stark beeindruckt. Er war ein starker Künstler im Stile der 70er Jahre: roh, hart, direkt, voller power, aggressiv, beißend, ironisch, weltgewandt und philosophisch. Sie hatten sich strahlend begrüßt, sie hatte ihm in Form eines Fotos eine verspätete Antwort auf eines seiner Kunstwerke gegeben und im Blitz von einem Moment strahlte in ihnen beiden etwas Versunkenes wie eine alte Freundschaft auf. Sie war nur enttäuscht, daß er dem Alkohol verfallen war. Dies sollte ihr eine Warnung sein!
Sie war ein wenig erschöpft von dem vielen, allzu vielem Alkoholgenuß. Irgendeine Aufgeregtheit in der Begegnung mit Menschen suchte sie dadurch zu überspringen. Ihre Menschenscheu. Die Ungeübtheit im Umgang mit Menschen. Diese Außenrolle hatte sie bisher immer ihrem Compagnon überlassen.
Sie liebte an einem verregneten Sonntag zu träumen.
Manchmal mochte sie allerdings auch die Peitsche knallen lassen, wenn die Herren allzu selbstgefällig wurden. Mehrere Eisen im Feuer zu haben war ohnehin die einzige Lösung gegen das Fehlen des Einen. Da war Hamid [Ludin], da waren Hannes und Walter, da waren Christian, Franz, Andreas und Matthias. In der Ferne waren ihre Brieffreunde: József [Tillmann], Johannes [Gachnang], Aurel [Schmidt], Paul [Virilio] … Die Fülle war aus der Leere hervorgegangen.
Sie hatte Jus angerufen und um einen handwerklichen Rat gebeten. Kurz danach klopfte er auch schon an die Tür. Mit ein paar Handgriffen und Tips konnte er ihr weiterhelfen. Er lieh sich das Auto und kam nach ein paar Stunden mit 3 frisch gepflückten blühenden Holunderzweigen zurück. Leider konnte sie ihm kein Abendessen anbieten, da sie zum Einkaufen nicht gekommen war. Er setzte sich trotzdem auf ein Glas Bordeaux zu ihr, ohne allerdings seine Jacke auszuziehen. Anderthalb Stunden saßen sie sich gegenüber und sprachen miteinander in einem ruhigen Ton. In seinen Augen spiegelte sich der Glanz der Abendsonne.
Nachdem sie ein paar Themen sprunghaft angerissen hatten, bei denen er stets mit besseren Kenntnissen aufwarten konnte, war sie direkt auf die Wünsche ihrer Träume zugesteuert. Sie entwarf das Bild von einem Haus in Indien, das sie beide bewohnen würden. Er zeigte ihr den Weg auf, wie so ein Haus mit Grund und Boden zu erwerben sei. Aber er zog sich zurück aus diesem Traum. Er wollte kein Haus besitzen und sich auch nicht als Makler betätigen, da er in Indien jederzeit Wohnmöglichkeiten hätte. Auch die Überlegung an ein gemeinsames Wohnen wies er mit dem Hinweis auf Wohngemeinschaftserfahrungen zurück. Außerdem wäre Indien viel zu weit weg und ohne eine eigene Arbeit würde man es sowieso dort unten nicht aushalten.
Sie entwarf das Bild, wonach sie auch dort unten ihrer Arbeit als Verlegerin mit Telefon + Fax + Computer nachgehen könne. Er wies diese Vorstellung ab und meinte, sie müßte als Künstlerin dort leben. Sie war erstaunt, daß er in ihr eine Künstlerin sah. Sie könne ja Kuchen backen, grinste sie. Ja, dann müsse sie aber mindestens 5 Kuchen und 5 Torten backen können, konterte er ernsthaft. Jedenfalls müsse sie parallel zu einem solchen Hausprojekt noch eine eigenständige Tätigkeit entwickeln. Er half ihr den Traum in Gedanken auszuspinnen, um sich dann daraus herauszuziehen. Sie würde dort allein sein. Das war kein Weg. Aber sie wollte doch mit ihm zusammen ein Stück dieser Träume verwirklichen! Nachdem sie für einen kurzen Moment den Raum verlassen hatte, stand er auf, zum Gehen bereit. Sichtlich bedrückt, den Tränen nahe. Sie legte ihren Arm auf seine Schulter, streichelte freundschaftlich sein Haar, dann war er fort.
Etwas war geschehen, Sie hatte ihn nicht ausreden lassen, sie war ihm ins Wort gefallen, sie hatte ihm nicht zugehört. Außerdem hatte sie wieder viel zu viel geraucht, obwohl er sie ausdrücklich gebeten hatte, damit aufzuhören. In ihren ausgesprochenen Träumen baute sie auf Jus und eine gemeinsame Zukunft, und er stahl sich betrübt davon.
Schnell war sie nach Hause geradelt und auf dem Teppich eingeschlafen. Am nächsten Morgen, während sie ihrer Tätigkeit nachging, bemerkte sie, daß sich ihr Mund merkwürdig geschlossen hatte. Noch immer sah sie seinen betrübt erregten Gesichtsausdruck vor sich. Etwas war geschehen.
Ein Anflug von Tränen überkam sie auf dem Fahrrad. Eine ungekannte Stille kehrte ein. Dann schlug sie im Lexikon den Begriff Symbol nach.
Sie beschloß, ihren Vortrag über die “Möbel der Zukunft” für den Herbst abzusagen. Jus hatte ihr klargemacht, daß die Wörter und das Schreiben nicht ihre Sache sein sollten. Still arbeitete sie an diesem Morgen an der Textredaktion und kam zügig voran. Am Nachmittag brachte ihre Nichte Christina, die sie zum Streichen der Tische engagiert hatte, eine frische Brise Teenie‑Schlager in den Saal. Nachdem der Computer an diesem Tag streikte, hatte sie vorsichtshalber den Ausdruck der gespeicherten Adressen angefangen. Spät nachts noch mußte sie immer wieder dem Drucker Papier nachfüllen. Dabei war ihr eingefallen, wie sie Jus zu seinem gesuchten Holz mit Borke für eine Designer‑Lampe verhelfen könnte. Endlich dämmerte der Satz: Mehr geben als nehmen.
Ihr Compagnon hatte sich vom Flughafen aus der Südsee gemeldet. Das Telefonat war etwas verquer, nicht nur weil sie wegen der Verständigung schreien mußte, sondern auch, weil ein unbekannter Mann neben ihr stand, der unangemeldet im Verlag hereingeschneit kam unter irgend einem Vorwand.
Der Tag war ohnehin merkwürdig. Der Übersetzer rief an, um die Verzögerung seiner Textabgabe anzukündigen, weil sein Computerlaufwerk kaputt gegangen war. Am selben Tag streikte die Tastatur ihres eigenen Computers. Diverse Telefonate kreuzten ihre Wege und Aufmerksamkeit. Es war wieder so ein Tag, an dem eine hohe Aufmerksamkeitsschwelle gefordert war.
Die Abschaffung des Fernsehens wirkte entspannend. Sie mochte den aggressiven Sound nicht und langweilte sich nur davor. Die Morgennachrichten im Radio mit anschließender Presseschau genügten als Information.
Es war verrückt. Sie war morgens gegen 5 Uhr aufgestanden, hatte stundenlang Briefe geschrieben, dann Texte redigiert und zurückgezogen im Einklang mit sich selbst gelebt. Da rief Cathy an, die junge Amerikanerin, und wollte vorbeikommen, sich ein Buch ausleihen. Und noch während sie einen Brief an Sylvère Lotringer in N.Y. schrieb und Cathy erwartete, schneite Jus herein. Die Farben seiner Kleidung waren kräftig erblüht, und er trug eine neue Brille. Sie sprachen über Farbnamen wie Petrol und Türkis. Dann gab sie ihm einen Zeitungsartikel mit der Überschrift “Das Glück trotzt der Kontingenz”, worin ägyptische und indische Philosophie eine Rolle spielten. Sie hatte darin einen Gedanken gefunden, den auch Jean Grenier in seinem Indienbuch geäußert hatte. Es ging um den Kult des Göttlichen, worin intellektueller Enthusiasmus mit dem Geschmack an der Aktion gepaart war, “denn wer Aktion sagt, sagt Glauben an den Wert der Person und an die Wirksamkeit seiner Wünsche.” Kurz: Aktion, Kreation, Liebe!
Sie warteten noch auf Cathy, die mit einem gelben Blumenstrauß und Räucherstäbchen ankam, und schon sausten sie zu dritt im Auto hinaus aus der Stadt, den großen Holzhaufen suchend, den eine Freundin ihr für Jus beschrieben hatte. Während der Fahrt plauderte sie ungezwungen mit Cathy, die ganz glücklich in ihrem neuen Domizil war, das sie ihr besorgt hatte. Währenddessen lenkte Jus den Wagen zügig durch den Verkehr, hupfreudig ein Lied summend. War er selig? Immer war er unberechenbar, überraschend. Sie fragte Cathy nach dem englischen Wort für “fröhlich” oder “Freude”. Cathy meinte “happy” sei das richtige Wort. Sie fand es zu abgenutzt. Da bot Jus das alte Wort “joyous” an. Damit konnte sie leben. Er verstand sie eben!
Zurückgekehrt von der Fahrt, machte Jus sie noch mit einem Architekten, dem neuen Straßennachbarn, bekannt. Nachdem sie sich die Innenarchitektur betrachtet hatte, zog sie zusammen mit Cathy ab und plauderte mit ihr noch eine Weile über Klossowski, Nizon, Cixous, Achternbusch …
In den folgenden Tagen hatte sie sich auf die Arbeit eingelassen. Sie hatte die Jabès‑Übersetzung von Hanns Zischler überarbeitet, zwei lange Briefe an die Autoren Paul Virilio und Gilles Deleuze geschrieben, die grafische Gestaltung der Vertretermappe für die neue Berlin‑Vertreterin erledigt, die Adressenkartei aus dem Computer ausgedruckt, die Zitate für den Rückendeckel von Dirk Baecker Postheroisches Management ausgewählt und war alles in allem zügig damit vorangekommen. Vielleicht sogar ein bißchen zu flott, denn sie war körperlich ein wenig erschöpft. Das lag aber auch daran, daß sich die innere Unruhe nicht legen wollte, die möglicherweise aus dem Zustand des Alleinseins herrührte. Auch wollte das Essen und Schlafen nicht so recht klappen. Sie hatte zwar Hunger, aber keinen Appetit. Sie war zwar müde, konnte aber nicht schlafen. Das zehrte an den Kräften.
Nach drei Tagen rief Jus wieder an. Er zwitscherte geradezu und schien guter Dinge. Er wollte nur Bescheid sagen, daß er heimlich wie ein Heinzelmännchen den Scheibenwischer am Wagen repariert hatte. Außerdem wollte er den Termin durchsagen, an dem er den großen Transporter zur Verfügung hätte, um einige Merve Bücher zu entsorgen. Sie versuchte noch, ihn für eine Sonntagsspazierfahrt zu gewinnen, mit dem Hinweis auf “Familientag” lehnte er ab. Die Freude war also immer überschattet von Zurückweisung.
Sie hatte eine Abendgesellschaft zusammengestellt, wobei sie eigentlich nicht wußte, was sie tat. Alles war stark improvisiert. Das Tischtuch war zu kurz, sie hatte keine richtigen Stühle, die Kochtöpfe waren zu klein, die Servietten fehlten, sie hatte keinen richtigen Brotkorb, Pfeffer und Salz fehlten auf dem Tisch. Dafür hatte sie die originelle Idee ihres Kompagnons auf gegriffen, nach einem Rezept des Komponisten John Cage zu kochen. Cathy hatte das für sie bewerkstelligt.
Und alle kamen. Die Herren brachten jeder eine Flasche edlen Wein mit. Es war eine Tischgesellschaft für 8 Personen. Und sie betrank sich füchterlich. Gottseidank lief ihr alter Freund Hamid zu Hochform auf und unterhielt die ganze Gesellschaft. Am Ende lachten sie alle Tränen.
Ihre Wohnung war ein Schatz. Da machte sie sich einen Tee, setzte sich auf den Teppich, zündete Räucherstäbchen an und fand Ruhe.
Es war Sonntagmorgen und die Sonne schien. Sie war früh aufgestanden und in den Verlag geradelt. Diese Sonntage, diese Familientage, waren für sie als “alleinstehendes Frauenzimmer” schwer zu überstehen. Sie würde sich also in aller Stille über die Redaktionstätigkeit beugen, wobei sie für eine Weile die ungestillten Sehnsüchte vergessen konnte. Sie war noch nicht weit gekommen in der hohen Schule der Einsamkeit. Immer wieder den einen einzigen abziehen, damit die Fülle des Lebens hereinströmte. Immer wieder der Versuch, vom Ufer abzustoßen. Noch fehlte der Mut, sich weit hinauszuwagen ohne Wiederkehr.
Wie hieß es doch bei Deleuze: “Man muß vom kreativen Schaffen sprechen als etwas, das einen Weg zwischen Unmöglichkeiten sucht … Kreatives Schaffen findet in Engpässen statt. – Ein Schöpfer ist jemand, der seine eigenen Unmöglichkeiten schafft und gleichzeitig Mögliches … Solange man nicht einen ganzen Komplex von Unmöglichkeiten hat, wird man nicht diese Fluchtlinie finden, diesen Ausweg.”
Würde sie Künstlerin genug sein, um diesen Ausweg hervorbringen zu können? Bislang fehlte es ihr an Umsetzungsqualitäten. Dabei zeigte ihr doch Jus, wie man es machte. Er war ständig in Aktion.
Isolde [Eckle] war überraschend aus London zu Besuch. Schnell trafen sie eine Verabredung, und schon Stunden später sprachen sie über ihr Leben und die Männer. Mit einem Pernod und einem Grappa wurde das Herbe dieses Kapitels lachend hinuntergeschluckt, und schon saßen sie im Konzert und ließen ihre Seelen fliegen bei dem süß‑traurigen Humor des südamerikanischen Komponisten “Alvaro”. Mit der Ironie eines Europäers und der Stimme eines Columbianers verführte er sie in eine warmherzige Welt, die den Schmerz der unerfüllten Sehnsucht kennt.
Sie mußte lernen, mit der Einsamkeit umzugehen. Sie merkte, daß sie schamlos war. Sie kannte keinen Respekt und kein Maß. Sie besaß nicht die Kontrolle über sich. Und da war niemand, der sie beschützte. Aber sie lernte Erfahrungen machen. Sie verfügte immerhin über eine gehörige Portion Stabilität, so daß sie nicht gleich in Panik verfiel, wenn während ihrer Abwesenheit versucht worden war einzubrechen.
In ihrem Werden spielte der Traum eine große Rolle. Endlich hatte sie Muße zu träumen. Und wenn sie ausgeträumt hatte, war sie erleichtert.
Langsam strömte ihre Einsamkeit ihrem Tiefgang entgegen und die anfängliche Leichtigkeit wich dem Ernst, der aus Trauer und Bitternis geboren wurde. Sie hatte die Pforten zu weit geöffnet. Und sie mußte einen Weg finden, den sie mit Stetigkeit begehen konnte, so daß sie nicht allzu sehr allen Schwingungen und Stimmungen ausgesetzt war. Die Arbeit im Verlag bot diese beständige Stütze.
Auf dem Heimweg war sie an einer offenstehenden Kneipentür vorbeigeradelt und hatte daraus den Satz aufgeschnappt: “In der Ruhe liegt die Kraft”. Ja, das war’s!
In diesem Frühjahr hatte sie sich zu den Sternen aufgeschwungen. Sie hatte die Weltkarte eingerollt und in die Zimmerecke gestellt und stattdessen die Sternenkarte neben dem Bett aufgehängt. Und manchmal hatte sie sich für die Zeit einer Ewigkeit in der Betrachtung der Konstellationen der Gestirne verloren. Endlich kam Abwechslung in den Monolog. Sie saß auf dem Flughafen Tegel und wartete auf ihren Abflug nach Bologna, Italien, da traf sie durch Zufall Isolde, die auf ihren Abflug nach London wartete. Und sie freuten sich, daß sie beide am 15. Juni um 15 Uhr in der Luft sein würden.
Der Flug über die Alpen war ein Traum. Der Flughafen Bologna dagegen Provinz. Aber kaum ein paar Schritte vom Hotel Roma entfernt, entfaltete sich die Pracht der alten Bauten in sommerlicher Wärme. Und alles flanierte, saß um die alten Brunnen und palaverte. Eine intakte Öffentlichkeit, nichts von dem, wovon am nächsten Morgen auf der Cybernautic-Konferenz die Rede war.
Das Abendessen mit einem siebensprachigen gewandten Perspektiven‑Spezialisten aus Toronto vom berühmten McLuhan‑Institut im Palazzo Montanari. Fürstlich, nur für geladene Gäste. Sie genoß in vollen Zügen die fast höfische Atmosphäre. Dafür waren die Italiener gut, hier verstanden sie zu leben.
Am Morgen im Hotel der Kater, der Husten. Doch der ritterliche Konferenzteilnehmer Kim Veltmann begleitete sie aufmunternd zu der alten Kirche, in der die italienischen Herren ihre selbstgefällig Rhetorik über die Stadt und die Technik entfalteten. Sie verließ still die kühle Dunkelheit des Ortes, trat hinaus in den Frühsommer Italiens, zwei, drei Schritte und schon lud ein Straßencafé ein zum Espresso unter den schattigen Kolonnaden.
Auf der internationalen Konferenz, an der Technikexperten und Politiker gleichermaßen engagiert sind, werden ernste Fragen zum Strukturwandel der Öffentlichkeit gestellt. Wie werden die Highways der Datennetze kontrolliert? Gibt es eine rechtliche Grundlage dafür? Ist die Demokratie dadurch in Gefahr oder ist es eine radikalisierte Demokratie von unten? Die Intervention des Franzosen [Philippe] Quéau unterbrach die italienische Redseligkeit, indem er mit dem Wort “Waffe” alle aufschreckte. Was, wenn nicht schon heute Drogenverkehr, Waffenhandel und internationale Mafia sich dieser neuen Instrumente bedienen? Diese Aktualität seines Beitrags zog die Technologie‑Konferenz ins Diesseits. Ein Satz daraus fand nickende Zustimmung: “Die Ökonomie ist heute nicht in der Lage, die virtuellen Werte in ihr System zu übersetzen bzw. aufzunehmen”.
Am 2. Tag der Konferenz war dann sie selber an der Reihe vor ca. 300 Zuhörern in der Kirche ihren Vortrag über Technik und Wahrnehmung auf Englisch zu halten. Sie mußte schon allen Mut zusammennehmen, um die Sache fehlerlos über die Bühne zu bringen. Es war aber ein erhebendes Erlebnis, die eigene Stimme durch das hohe Kirchenschiff schwirren zu hören.
Nils Röller war extra aus Köln angereist, und nachdem sie ihn mit einigen Konferenzteilnehmern bekannt gemacht hatte, verließen sie zusammen den Ort, um ein bißchen durch die Stadt zu schlendern. Beim Lunch und Dinner im “Palazzo der Drucker” konnte sie dann durch die Anwesenheit des sehr viel jüngeren Nils den arroganten selbstgefälligen italienischen Herren eins auswischen. Sie waren nämlich einigermaßen baff, daß eine Frau ihnen ihr Spiel mit umgekehrten Vorzeichen vorführte: “Ältere Frau leistet sich jüngeren Liebhaber für die Dauer einer Tagung”.
Daß der junge Mann dann mangels Finanzen in ihrem Hotelzimmer zu ihren Füßen auf dem Boden campierte, stand auf einem anderen Blatt. Trotzdem hatte ihm diese Variante der kleinen Heimlichkeit einigermaßen gefallen, so daß er rot anlief, als sie am Morgen durch die Hotelhalle hinausschritten.
Nun saß sie im Schatten der Bäume im Süden Italiens und hing ihren Gedanken nach. Sie genoß diesen Tag der Ruhe, an dem sie durch die Kolonnaden schlenderte, ab und an in einen prachtvollen Innenhof schaute und in den romanischen Backsteinbauten von St. Stefano die klösterliche Stille fand.
Sie war aus der geduckten Kleinheit herausgetreten und hatte zu der ihr angemessenen Größe gefunden. Immerhin war sie den ehrlichen Weg der erworbenen Erfahrungen gegangen, und das war der Reichtum, aus dem sie nun schöpfte. Natürlich waren die ersten Schritte auf diesem Terrain noch unsicher, aber sie fand immer einen Ritter, der sie bewunderte und beschützte.
Zurück in Berlin erwartete sie Jus mit dem Wagen am Flughafen. Er hatte den Wagen gewaschen, ein Räucherstäbchen in dem geleerten Aschenbecher entzündet und eine Tüte Lebensmitteldosen für sie eingekauft, womit sie nun zu einer Sonntagnachmittagsgesellschaft von Regina Poly düste. Dort fand sich ein erlesener Kreis aus Künstlern, Intellektuellen, Schauspielern, Ärzten und Weinhändlern, die munter in der Sonne plauderten. Eine Atmosphäre der Entspannung. Aber sie war zu erschöpft von der Reise, um sich wirklich aktiv dazu beizutragen.
Ihr Compagnon hatte zwei wunderschöne Briefe aus der Südsee geschrieben. Wie warmherzig und tapfer er doch war! Sie hatte seit über 10 Tagen nichts mehr von ihm gehört und wußte ihn doch weit draußen in der Welt ganz einsam.
Ihre Schwester war aus Westdeutschland gekommen und hatte von dem Umzug der Eltern Sessel aus den 50er Jahren mitgebracht. Aber eigentlich war sie gekommen, um sich auszusprechen. Ihr einziger Freund war plötzlich gestorben, und sie weinte bitterlich darüber. Sie saßen wohl bald 3 Stunden beisammen und sprachen zum ersten Mal miteinander wie Freundinnen. Und sie fanden so vieles, was sie gemeinsam hatten, daß sie sich darin geborgen fanden.
Am 21. Juni um 11 Uhr war Jus mit dem geliehenen Transporter gekommen, alte Bücher zum Altpapier befördern. In ihrer Abwesenheit hatte gerade eben zu dieser Zeit ihr Compagnon aus Bangkok angerufen und sich gewundert, daß sie nicht anzutreffen war. Sie kannte das Spiel der Zahlen im Kalender nicht. So hatte sie sich wohl verladen lassen.
Am folgenden Tag war sie umso mehr nervös und auch glücklich, daß Nana [Suzuki], die japanische Künstlerin, sie kurz besuchen kam. Sie bestätigte damit ihr altes Zeitrhythmusmaß. Nachdem sie den ganzen Tag über schwer zu kämpfen hatte mit den Mäandern und Mosaiken der zerfallenden Wahrnehmung, fand sie am Abend im Konzert von Joëlle Léandre Freude und ein Publikum und ein Konzert mit hervorragender Lichtregie, das sie mit allem versöhnte. Cathy und Almut [Carstens] waren gekommen, Folke und Nana, sie sprach mit Michaela [Ott] und der Frau aus Tokyo, Ulrike Ottinger kam auf sie zu und wechselte ein paar Worte mit ihr; sie fühlte sich heimisch in dieser Umgebung.
Zwei Tagesreisen im Auto mit ihrem Neffen Thomas nach Braunschweig zu den alten Eltern, ihnen nach dem Umzug helfen, den alten Garten wieder etwas auf Vordermann bringen. Auf der Heimfahrt dann mit Entenkücken auf dem Schoß. Kaum war sie angekommen und hatte den überflüssigen Babel ausgeladen, war sie auch schon wieder froh, dieses familiale Einerlei hinter sich zu lassen. Zum ersten Mal war ihr klargeworden, daß die Family sich keinen Deut für sie interessierte. Und eigentlich wollten sie einem nur ihre alten Reste aufladen. Sie war wirklich froh, als sie wieder die Ruhe ihrer kleinen Einzimmerwohnung umgab.
Die neue Woche hatte damit begonnen, daß Jus ihr vom Unfall demoliertes Fahrrad reparierte und einen Wärmestrahler an der Wand anbrachte. Sie hatten dabei ein alltägliches Verhältnis, das keinerlei Sondersituation zuließ. Sie arbeiteten im selben Raum, dabei spielte er alte Platten, und ab und an flogen ein paar belanglose Sätze durch den Raum. Sobald seine Arbeit beendet war, zog er eilig von dannen.
Jus war gekommen, um den Designerthron zu entsorgen, den seine Freunde vor über 8 Jahren als Modell entworfen hatten. Nun war er überflüssig geworden; selbst seine Schöpfer bezeichneten ihn als Irrtum und wollten davon nichts mehr wissen. Jus nahm sich des Problems an, obwohl es ihn eigentlich nichts anging. Er ging zügig an die Arbeit und wollte sich weder helfen lassen, noch sich in ein Gespräch verwickeln. Öfters tat er sogar so, als hätte er sie nicht gehört. Und manchmal schien er ihr sogar unwirsch. Dann zog sie sich hinter ihr Buch zurück und ließ ihn in Ruhe. Pünktlich nach zwei Stunden räumte er die Reste zusammen, fegte den Boden auf, montierte noch ein Schutzblech an ihrem Fahrrad und brachte einen Teil des Mülls in den Hof. Dort gab sie ihm das Geld, dankte tausend Mal, worauf er sie lächelnd ansah, und schon radelte er fort.
Schon bei den letzten Malen war ihr aufgefallen, daß er sich nicht hinsetzte, daß er nichts zu trinken annahm, daß er das Gespräch vermied. Aber auch sie war gelassener ihm gegenüber: keine Hemmungen, keine Scham, keine Verklemmtheiten.
Sie saß auf dem Teppich, hatte eine Kerze angezündet und trank ein Glas Leitungswasser. Sie war mit sich und der Welt im Reinen. Nun konnte sie sich dem Verlag widmen. Und das mußte sie auch, denn die Bücher ließen zu wünschen übrig. Sie würde gerne das Buch machen von Jean Grenier über Indien. Und sie hatte sogar dafür schon eine Coveridee.
In ihrer unstillbaren Unruhe tat es gut, schon wieder im Flugzeug nach Stuttgart zu sitzen auf dem Weg zur Akademie Schloß Solitude, wo sie als Jurorin für Design tätig war. Diesmal war geladen zum großen Sommerfest, umrahmt von Kunsteinlagen. Eigentlich ein völlig überflüssiger Luxus, wobei sie eigentlich auch nicht wußte, was sie da sollte. Immerhin konnte sie die letzten Tage der Erwartung, der Rückkehr ihres Compagnons damit überbrücken. Sie war ja schon so gespannt auf den Moment der Landung, wenn Peter und Jus sie am Flughafen erwarteten. Es schien ihr heimlich Freude zu bereiten, daß Jus Peter in Empfang nehmen würde und die beiden Männer wiederum sie willkommen heißen. Was für eine Inszenierung! Wobei der geheime Sinn dieses Spiels sich ihr selber nicht offenbarte.
Das Sommerfest auf Schloß Solitude war nicht gerade großzügig. Würstchenbuden, Jahrmarktsbänke und Getränke, die man selber bezahlen durfte. Sie traf ihre Stipendiaten, einige Juroren, Patricia Schwarz und René Straub und hielt sich wacker von 16 bis 24 Uhr redend, stehend, partymäßig. Dafür war der nächste Tag zäh. Es gab im ganzen Haus nichts zu essen, sie hatte Kopfschmerzen und die finanzielle Reisevergütung fand auch nicht statt. Sie legte sich wieder ins kühle Studiobett und schlief gründlich aus. Ein kurzer Besuch bei ihrer italienischen Stipendiatin gestaltete sich eher langweilig mit deren globalen unqualifizierten Einschätzungen. Ein Versuch, den Stuttgarter Stipendiaten zu sprechen, scheiterte daran, daß er noch vorn Vortag übernächtigt war; und den russischen Stipendiaten mied sie, weil er ihr zu sehr im Militariabereich seine Arbeit sah.
Endlich saß sie wieder auf dem Flughafen und freute sich auf den Heimflug, auf das Wiedersehen. Jus hatte zuverlässig Peter am Flughafen erwartet. Als sie eintraf, saßen die beiden Männer einträchtig ins Gespräch vertieft, so daß ihr Compagnon sie erst sehr spät bemerkte. Schnell saßen sie im Wagen, und während Jus stumm durch den Verkehr lenkte, plauderte sie mit Peter alles durcheinander. Zwei Welten prallten aufeinander. Er wollte von seinen Urlaubserlebnissen erzählen, sie wollte so schnell wie möglich einen Teil der Sorgenlast loswerden. Nach einem Begrüßungstrunk ließ sie Peter erstmal ausruhen und ging allein heim.
Der erste gemeinsame Arbeitstag war eine Katastrophe. Sie schwankte zwischen Entsetzen und Verzweiflung. Als die erste Besucherin in den Verlag kam, stellte Peter zwei Gläser auf den Tisch, schenkte der Französin ein, setzte sich auf den Chefsessel und begann das Gespräch. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich ein eigenes Glas aus der Studioküche zu holen, sich selbst einzuschenken und sich daneben zusetzen. Damit war sie für den Rest des Tages bedient. Es war zum Heulen. Und das arme Papier mußte ihre wechselnden Befindlichkeiten erdulden!
Sie löste das Problem durch eine getrennte Aufgabenverteilung, der ihr Compagnon nur unwillig zustimmte. Sie schnappte sich am folgenden Tag einen Teil der Serres‑Texte und zog damit von dannen. Bei der exzellenten Übersetzung war die Arbeit schon nach einem halben Tag getan, so daß sie sich zusätzlich noch der Buchhaltung widmete, während ihr Compagnon mit den zähen Folgen einer falschen Wahl des Übersetzers zu kämpfen hatte. Somit konnte sie einen Teil der Last auf ihn abwälzen, für die sie nicht gerade zu stehen hatte.
Der erste Schock löste sich in Tränen auf, nachdem Jus zu Besuch gewesen war und sie sich für die beiden Männer in Luft auflöste. Nun war ihr Alleinsein zum erstenmal ein uneinnehmbarer Punkt des Widerstands. Obwohl ihr schon öfters zum Heulen zu Mute war, liefen zum ersten Mal seit 8 Jahren die Tränen. So traurig das war, es hatte auch sein Gutes. Irgend so ein Knoten hatte sich gelöst und schwamm in Tränen davon.
Es tat ihr leid, denn immerhin hatte Jus sie abends angerufen und zum Essen eingeladen. Stattdessen fuhr sie mit dem Rad zum Tempodrom, wo umsonst und draußen Musik der Mittelmeerländer spielte. Schon am nächsten Morgen stand Jus wieder in der Tür. Er hatte eine neue Autoreparaturwerkstätte ausfindig gemacht und brachte nun den Wagen dorthin. Sie fuhr zwar mit, ließ ihn aber die Verhandlungen führen. Gemeinsamer Spaziergang heimwärts.
Das Schreiben erlahmte. Die Bedingung der Einsamkeit war nicht mehr gegeben. Dabei war der Aufruhr der Gefühle noch nie so stark. Sie hätten auf dem Spaziergang besser Mißverständnisse klären sollen als über Küchengeräte sprechen. Aber die Saftpresse war seine symbolische Art, den verpatzten Abend zu überwinden:
“Es nützt nichts, die Möhre einfach hineinzustecken, dabei fließt kein Saft. Man muß sie erst noch raspeln.”
Freud hätte seine Freude daran gehabt. Er versuchte, irgendetwas wieder gutzumachen. Und meinte, er hätte sie am Vortag überfahren. Sie wußte selber nicht, was vorgefallen war.
Als sie vom Bovril und dem Gespräch mit der Landschaftsarchitektin in die Verlagsetage kam, war Folke Hanfeld mit dem Aufbau seiner Ausstellung beschäftigt und endlich war wieder der große Fabrikraum in seiner Alltäglichkeit entgrenzt. Ihr Compagnon lief dementsprechend unkoordiniert durch den Raum und versuchte mit einer Auswahl von Titeln aus dem Verlagsprogramm das ganze Unternehmen zurückzubinden auf das Haus oder das Dach, unter dem die ganze Aktion stattfand. Später stieß Jus noch zu dem unkoordinierten Haufen, der doch mit System arbeitete. Bei einer Hauslieferung Pizza saßen sie lange und plauderten durcheinander über Perspektive, Technik und mancherlei Ungeklärtes. Sie trank und redete und rauchte und verhielt sich ganz zwanglos. Die Männer verstanden sich glänzend, das eine oder andere Mal gaben sie dem Künstler Ratschläge für eine andere Hängung. Sie hob noch einmal hervor, daß der vorletzte Satz seines Konzept‑Textes den entscheidenden Anlaß für die Ausstellung gegeben hatte. Schließlich verließen sie den Raum, jeder in eine andere Richtung heimwärts strebend.
Und ihr Compagnon wunderte sich, wieso sie alleine im Regen im Dunkeln betrunken nach Hause radelte. “Wieso”, antwortete sie, “ist doch gut für den Teint”. Währenddessen die beiden anderen Männer, der eine mit Regenschirm, der andere mit Kapuze, daneben standen und höflich zum Abschied grüßten.
Sie hatte sich eine Unabhängigkeit erobert, die keine Härte scheute. Mit gespanntem Rücken saß sie neuerdings da und vergaß nie die Maske des Lächelns, auch wenn ihr zum Heulen zumute war. Sogar die Kunst des Schweigens begann sie auszuloten.
Die Ausstellung von Folke Hanfeld in den Verlagsräumen war gelungen. Perfekte Beleuchtung, saubere Passepartouts, eine komponierte Hängung, zwei Erlenholz-Polyeder als Skulpturen auf einem Sockel im Raum. Dazu ein feiner Sonderdruck, den sie immer wieder in die Hand nahm und rätselnd darin blätterte. Der Eröffnungsabend war ein glänzendes Fest geworden. Sie hatte den Abend selbst genossen und mit vielen gesprochen: mit Blixa Bargeld, Durs Grünbein, Ulrike Ottinger, Hanns Zischler, Christian Bertram und vielen alten Freunden. Schnell war der Wein geflossen und die Gäste gegangen; wie im Rausch war es an ihr vorbeigeflogen. Noch den ganzen nächsten Tag hingen ihre Gedanken dem Abend nach. Dann verfiel sie wieder der Einsamkeit. Ihr fehlte ein Freund, der sie ab und zu verwöhnte. Oder eine Sache, die sie erfüllte.
Da ihr Compagnon sie ständig ansprach und auf sie einredete, hörte sie ihre eigene innere Stimme nicht mehr. Und weiterschreiben in dieser Form schien ihr zwecklos. Die vielen wechselnden Eindrücke überschlugen sich und hinterließen ein allgemeines Rauschen. So war sie froh, daß wieder ein Berg Arbeit vor ihr lag, der ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Diese selbstauferlegte Freizeit an den Sonntagen führte zu nichts. Sie sollte sich stattdessen der Instrumente bedienen, die ihr zur Verfügung standen und Berechnungen anstellen zur Analyse des Beziehungsgeflechts.
Sie sinnierte über den Spruch: “Abwarten und Tee trinken”. Jeden Abend, wenn sie nach Hause kam, zog sie als erstes die Schuhe aus, setzte Wasser auf, stellte die Tasche ab und packte aus. Dann goß sie den grünen Tee auf, stellte ihn auf eine Kachel auf den Teppich, setzte sich daneben, und während sie abwartete, bis der Tee gezogen hatte, tat sie gar nichts weiter. Wenn die Zeit gekommen war, goß sie eine weiße Porzellantasse voll und begutachtete die Farbe und den Geruch. Der chinesische Gun powder schmeckte bitter wie schwarzer Tee, hatte eigentlich auch nicht die typische Färbung wie der grüne japanische Tee und hatte auch nicht die Konsistenz von grünen Blättern, sondern sah wie geröstete Kügelchen aus. Sie goß frisches Wasser nach, so daß die zweite Tasse geringer konzentrier war. Sie würde dem grünen Tee nachgehen, denn sie hatte noch nicht die eine unverwechselbare Sorte wiedergefunden, die sie zusammen mit ihrer Teekanne in einem japanischen Töpferdorf in der Präfektur Ibaraki gekauft hatte. Und mit einem Male wußte sie, sie war auf dem Tee-Weg.
Der Abend verlief friedlich ohne jede Unruhe. Sie hatte nebenbei noch eine Gänsebrust im Ofen geschmort, einige interessante Zeitungsartikel gelesen, ein paar Briefe geschrieben und sich dann aufs Bett gelegt zum Lesen des Buches “Seltsame Einsamkeit”. Es enthielt eine Erklärung, wieso jemand zum Schreiben kommt: aus Liebesschmerz. Und wie die Einsamkeit im Abschied von der Jugend zum uneinnehmbaren Punkt wird.
In diesen Tagen lag etwas Besonderes in der Luft. Sie konnte nie genau sagen, wodurch es sich ankündigte, aber dann klingelte das Telefon öfter, alte offene Fragen wurden beantwortet, Verträge ausgehandelt, Entscheidungen getroffen. Wie wenn plötzlich alles gleichzeitig in Fluß kam. An solchen Tagen wurden Rechnungen bezahlt, trafen säumige Übersetzungsarbeiten ein, ja sogar der Verkehr auf den Straßen änderte sich. Entweder schienen alle Firmen sämtlicher Branchen am selben Tag ihre Ware anzuliefern, oder aber in Teilen der Stadt fielen die Verkehrsampeln aus oder dergleichen …
Sie war an diesem Tag schon am frühen Nachmittag nach Hause gegangen, schon allein deshalb, weil es dort viel kühler war. Sie hatte die Sender des Weltempfängers solange durchgecheckt, bis sie die Nachricht bestätigt erhielt, daß an diesem Tage auch der amerikanische Präsident das Brandenburger Tor von West nach Ost durchschritten hatte, was die vielen Helikopter über der Stadt erklärte. Da aus diesem Grunde der ganze Norden der Stadt abgeriegelt worden war, wie ein privater Spediteur sie unterrichtete, würden die nächsten 90 Seiten Übersetzungsmanuskript aus Wiesbaden erst am folgenden Tag eintreffen. Mit dieser Information war der Tag für sie gelaufen. Sie konnte einpacken und nach Hause gehen.
Sie begann sich für das Handeln zu interessieren. Für den Pragmatismus. Denn immerhin vollbrachte sie über die Bewältigung des Betriebes hinaus einige einschneidende Leistungen, sobald sie allein Regie führte. Schon mit der Option für die Managementphilosophie hatte sie Ansätzen zu einer Handlungstheorie publizistisch den Weg bereitet.
Zur Zeit lebte sie nur von einem Tag zum nächsten. Abends hoffte sie, daß endlich morgen ein neuer Tag anbrechen würde, und tags hoffte sie, daß endlich Abend sei. Dieser kurzatmige Zeitrhythmus hatte mit ihrer rigiden Zeit- und Raumeinteilung zu tun. Tags im Verlag, abends in der Wohnung. Im Verlag erwartete sie der Betrieb, der Haushalt und das Lektorat, zu Hause der Tee, das Schreiben und das Lesen. Dem Ganzen fehlte der große Spannungsbogen. Immer kam es ihr so vor, als müßte sie eine Wahl treffen. Und immer, wenn sie vorauseilend die möglichen Konsequenzen überschaute, wußte sie um die Gefahr, den Rest ihres Lebens in irgendeiner Nische zu verbringen. Würde sie jemals eine Wahl treffen? Eigentlich suchte sie nach ihrem Zugang zur Welt. Und sie suchte nach dem geeigneten Werkzeug. Sicherlich war sie noch fern vom Ziel, aber das machte nichts. Denn sie glaubte, nicht mehr allzu fern vom Realen zu sein.
Jus hatte es wieder geschafft, sie mit einem geschickten Schachzug auszutricksen. Kaum war ihr Compagnon zurück in Berlin, ließ er sich nur noch bei ihm blicken und schaltete sie aus.
Endlich war sie wieder versöhnt. Es hatte eine Aussprache mit ihrem Compagnon gegeben und sie konnte ihm begreiflich machen, mit welcher unverantwortlichen Abdrift er seinerseits das Verlagsunternehmen gefährdete. Schließlich kam am nächsten Tag Jus und reparierte ihr Fahrrad. Damit war die Welt wieder in Ordnung.
Die Schulferien begonnen, die Reisewelle setzte ein, plötzlich Stille. Ah. Ein großes Aufatmen. Sie hatte seit einer Woche keinen Alkohol mehr getrunken, wodurch die Erschöpfung sofort nachließ. Sie machte kleine Erledigungen gewissenhaft, aber ließ von dem Drang ab, der sie zur Arbeit trieb. Ihr fehlte die Dimension des Wunderbaren und Glückhaften. “Du sollst nicht soviel denken, sondern aus dem Bauch heraus das machen”, sagte Jus neulich unvermittelt. Sie war für die anderen Menschen zu kompliziert.
Das Schreiben führte zu nichts. Die seltenen Vorträge ermöglichten ihr nur gelegentliche Reisen, kosteten viel Arbeit und brachten nichts ein.
Ein Abendessen bei ihrer alten Freundin Almut war schrecklich. Es sollte ein Abschiedsessen für Cathy sein. Und Cathy fiel erstmal nichts besseres ein, als dasselbe Cage-Essen zu kochen, wie sie es vorgeschlagen hatte. Den Rest des Abends saß sie steif da und sagte nichts oder ab und zu “Ja, das ist interessant”. Wenn man nachfragte, was interessant sei, dann redete sie sich raus, sie könnne das auf Deutsch nicht so sagen. Mühlenbrock rannte immernoch den Berühmtheiten hinterher und brachte doch keinen Film zustande. Lucia mit tiefem Dekolleté beklagte sich wie immer über grapschende Männer. Die Portugiesin lebte in Deutschland, aber schwärmte von Lissabon, die Irin lebte in Deutschland und klagte über Belfast. Es kam kein Gespräch zustande. Nach drei nüchternen Stunden bei Mineralwasser ging sie allein nach Haus. Ihr Compagnon Peter verbrachte diesen Abend auf einer Cocktailparty, wollte vielleicht später noch vorbeischauen, aber darauf wollte sie nicht warten. Sie musste das Tief der Nüchternheit allein durchstreifen.
Und sie war gewillt, dies allein durchzustehen, denn nur so konnte sie den Widerstand der Unabhängigkeit aufbauen. Den harten Kern. Sie hörte The Shutov Assembly von Brian Eno. Ein sphärischer meditativer Klang, im Raum schwebend. Verträumte Unschuld.
Ihre Blutungen waren in letzter Zeit unregelmäßig und fast um eine Woche verfrüht, dazu ungewöhnlich stark und lange. Sie musste sich flachlegen. Leise säuselten die Maori-Gesänge durch die Berliner Sommerhitze. Trägheit machte sich breit.
Sie war zum Frauenarzt gegangen, weil die Blutungen nicht nachließen. Dessen Diagnose leuchtete ihr ein: keine Geschwüre, höchstens hormonelle Schwankungen oder verfrühte Wechseljahre.
In dieses Tagen hatte sich ein Jahrtausend-Ereignis am Himmel abgespielt. Ein riesiger Komet war auf dem Jupiter gestürzt und hatte dort einen Krater von mehreren Hundert Kilometern Durchmesser geschlagen. Sie hatte das Ereignis nicht im Detail verfolgt, glaubte aber, daß damit das neue Zeitalter eingesetzt hatte.
Sie hatte das II. Quartal ’94 der Buchhaltung kontiert und am DATEV-Computer ihres Steuerberaters eingegeben; sie hatte die ersten zwei Texte des Charles-Bandes über Musik und den Transzendentalismus auf ihrem Macintosh als Rohsatz eingegeben; sie hatte 40 Seiten der Serres-Übersetzung der Nord-West-Passage mit Günther [Rösch] redigiert; sie hatte in einem neuen Lokal ihren Compagnon bei einem Abendessen mit der neuen Verlagsvertreterin für Berlin bekannt gemacht: so sah ein Tag dieser Tage im Sommer ’94 bei ihr aus.
Sie hatte noch einmal versucht, Jus telefonisch mit einer Handwerksarbeit zu sich zu locken, aber er hatte abgewunken. Sie konnte noch so sehr um ihn herumscharwenzeln, there was no way. So gesehen konnte sie sich alle unnützen Deutungen und Strategien sparen. There was no way. Sie mochte auch diese Abende mit endlosen Gesprächen, die zu nichts führten, nicht mehr. Und es fiel ihr auf, daß sie alle Personen, die sie schätzte, nur maximal alle 14 Tage für maximal 1-2 Stunden traf. Und diese Begegnungen waren geprägt von einem hohen Maß an Sachlichkeit.
Sie hatte wieder Gräser gepflückt an den Ufern der Oder. Sie hatten auf Badetüchern im Schatten der Weiden gesessen und darüber gesprochen, daß die Dementierung des Subjekts die Voraussetzung für das Eintreten eines Ereignisses war. Und einer hatte noch von dem Eintreten der Götter gesprochen, während wieder ein anderer ausgestreckt im Grase lag und schnarchte. Man hörte den Wind in den Blättern der Weiden. Dann brachen sie auf. Auf der Heimfahrt in die Stadt schwiegen sie, blickten in die vorbeiziehende Landschaft und hörten Musik. Es war der 23./24. Juli 1994 und ein heißer klarer Sommertag. Sie hatten sogar in einem kleinen Waldsee mit Seerosen gebadet. Es kam ihr so vor, als sei sie weit weg gewesen. Die kleine Exkursion der Tausend-Plateaus-Lektüregruppe hatte sie erleichtert, beschwingt, erlöst.
Anderntags schlief sie lange, und als sie dann zum Verlag radelte, fand sie sich schön. Bereits am frühen Morgen lastete die Hitze über der leeren Stadt. Wilfried [Gärtner] kam aus Klassel auf einen kurzen Besuch, sie ging mit Günther ins Savo auf ein kurzes Gespräch, sie holte die Buchhaltung ab und beendete den Satz eines Serres-Textes am Computer. Abends verabredete sie sich mit Nils zu einem Soli-Salon. Sie amüsierte sich bei dem Gedanken, dort mit einem jungen hübschen Mann in Erscheinung zu treten. Ansonsten erwartete sie nicht gerade angenehme Überraschungen von diesem Abend.
Der Soli-Salon war ein verkappter Herrenstammtisch in ärmlichstem Junggesellenambiente. Robert Zank äußerte schnell und klar, daß es kein gemeinsames Thema der Beteiligten gab. Kapielski war zwar wie immer betrunken, aber legte sofort den Finger auf die Wunde, indem er den Gastgebern ihre Gott- oder Guru-Abängigkeit gegenüber ihrem intellektuellen Vorbild Oswald Wiener vorwarf. Nach dem wohlmeinenden Motto: Ihr seid zwar gut, aber so etwas braucht ihr doch nicht. Schnell war sie sich mit Nils darüber einig zu gehen.
Sie fuhren mit dem Fahrrad in die Bergmannstraße und fanden in einem Gespräch zueinander.
Sie wußte um das Ausmaß des Abdriftens ihres Kompagnons nicht ausreichend bescheid, um solche Aussprachen in Kneipen unter Freunden zu verhindern, wo er öffentlich seinen Überdruss oder sein Ende als Verleger kundtat. sie fand solche unreflektierten Verhaltensweisen verheerend, was den Ruf des Verlages anbetraf. Aber dadurch kristallisierte sich heraus, daß sie entschlossen war, den Verlag fortzuführen, während er die Sache aufgeben bwz. unrealisterweise andernorts fortführen wollte. Sie hatte bereits Ideen, wie die neue Buchreihe aussehen sollte.
In Berlin glühte seit 14 Tagen eine Hitze, wie es sie nur noch in Tunis gab. Die Menschen gingen in Badehosen einkaufen. Gegessen wurde fast nicht mehr. Die Restaurants bleibend gähnend leer. Sie freute sich, eine ruhige Tätigkeit zu haben, die keine große körperliche Anstrengung erforderte. Ab und an hielt sie den Kopf unter den Wasserhahn. Die Haut brannte auch dann, wenn man den ganzen Tag im Schatten verbracht hatte.
Jus hatte in ihrer Abwesenheit das Seitenfenster des Wagens repariert, die Bremsflüssigkeit erneuert und ein neues Fensterbrett für die Blumen im Bad angebracht. Womit konnte sie das vergelten? Sie lieh ihm hin und wieder den Wagen. Private Verabredungen dagegen hielt er sich vom Leib.
Mit Begeisterung redigierte sie Michel Serres Hermes 5. Die Nord-West-Passage. Sie sah diesem Autor zu, wie er um die Einteilungen der Wissensgebiete herumschiffte, um Berge von Vergeblichkeit. Da waren ihr doch die Einsichten eines Bergsteigers oder Polar-Expediteurs lieber.
Die Hitze war extrem trocken. Sie freute sich immer ungemein, wenn sie mal wieder ein Buch gefunden hatte, das sie interessierte und verschlang. So hatte sie nacheinander Kobe’s Schachtelmann, Alan Watt’s Dies ist Es und Schliemann’s Reise durch China und Japan im Jahre 1865 begeistre gelesen.
Es gab selten noch die herausragende Gestalt des Heiligen Weisen Irren in ihrer Zeit. Alles war möglich in dieser Zeit. Deshalb gab es auch dieses “Jenseits der Grenze”, von der etwas hereinbrechen konnte, nicht mehr. Folglich musste man sich weit hinauswagen. Wozu?
Sie hatte sich zur Kühlung ein feuchtes Handtuch auf den Kopf gelegt. Dann wieder umwickelte sie damit ihre Waden. Die Straßen waren außergewöhnlich leer.
Sie wußte nicht, was ihr an dem neuen Blumenfensterbrett so besonders liebevoll erschien: die Perfektion der Ausführung oder die Wahl des Holzes. Sie wußte es nicht. Vielleicht, weil es sich um ein Brett für ihre geliebten Blumen handelte?
Schon lange interessierte sie sich für Zahlen. Nicht im symbolischen Sinne, so als ob die Zahl 3 die heilige Dreifaltigkeit bedeutete, sondern eher im Sinne eines wechselnden Kalenders, der komplexe Systematiken enthielt.
In diesem Sommer erhilet sie des öfteren Komplimente über Schönheit und Jugend. Sie selbst empfand desgleichen. Die Haut hatte sich gespannt, der Ausdruck war entspannt bis fröhlich, die Kleidung verriet dezente Eleganz, die Körperhaltung straffte sich.
Jus arbeitete zügig und ohne zu reden. Sie sprach ihn mehrmals an, aber er schwieg dazu oder schüttelte stumm den Kopf. Eine merkwürdige Stimmung auf der Etage. Ihr Compagnon sah Nachrichten im Fernsehen in der einen Ecke des Raums, Jus arbeitete am Blumenfenster in der anderen Ecke des Raums, und sie selbst saß in der Mitte des Raumes und schrieb.
Es gab hin und wieder unangenehme Begebenheiten. Sie ging zu Jus, um sich nach dem Stand der Arbeit zu erkundigen. Erst nach einigem Zögern gab er Auskunft über sein Tun. Währenddessen nahm er die Arbeit wieder auf, und sie bot ihm frische Handtücher gegen den Schweiß. Dabei fiel ihm der Eimer mit dem Beton aus der Hand, er schrie auf und sagt mit der Geste des Vade retro rasch und laut: “Bitte gib mir keine Befehle!” Sie drehte sofort ab.
Es war Freitagabend, was immer eine besondere Stimmung verbreitete. Das einzige von Interesse war diesmal der Wetterbericht. Sie suchte ihrem Compagnon am Computer die Adresse seiner Abendverabredung heraus, weil er selbst seit mindestens 10 Jahren sein Adressbuch nicht erneuert hatte. Sie hatte ihm erklärt, wie er dorthin käme, sie hatte ihm das nötige Kleingeld für die U-Bahn gegeben und ihm ein Mitbringsel für Oded ausgesucht. Dann blieb sie allein zurück. Nachdem er gegangen war, erkundigte sich Jus, zu wem er gehen würde. Was hatte seine Neugier erweckt?
Der Mangel an Zigaretten machte sie nervös. Sie fragte Jus, ob er gern einen Bleistift von dem Erfinder des Bleistifts hätte, und seine schnelle klare Antwort erstaunte sie: “Ne”, sagte er, “das wäre ja viel zu verpflichtend”. “Ich wußte eigentlich nicht, was daran verpflichtend wäre”, ewiderte sie. Sie wußte es tatsächlich nicht. Schon bald war seine Arbeit beendet und sie fragte ihn offen, womit sie es vergüten könne. Er nannte ihr den Preis der Materialien und den seiner Arbeit. Mit 80 – 100 DM war die Sache abgegolten, je nachdem, ob sie das Holz und die Wand noch selber streichen wollte oder nicht. Er machte ihr die Sache einfach. Er wußte sich nützlich zu machen. Das war ihr viel wert.
Sie entdeckte die Musik von Debussy. Etwas Dezentriertes, Flirrendes, aber auch Getragenes. Lange Bögen und Wellen. Dann hörte sie zum ersten Mal Gorki, eine Art Mahler-Epigone. Schließlich landete sie bei Schönberg’s Verklärte Nacht. Sie mochte diese Klangteppiche, die sich ineinanderschoben, aufwölbten, auseinanderzogen, überlagerten.
Es war mittlerweile Mitte August. Die große Hitze hatte sich in einem Gewitterguß entladen, und nun strampelte sie in strömendem Regen entspannt hierin und dorthin. Nichts war besser für den Teint.
Seit mehr als einer Woche saß sie am Computer, erfaßte die deutschten Manuskripte von Daniel Charles, drucke sie aus, las Korrektur, übertrug die Korrekturen in den Computer, formatierte den Satz und fertigte einen 2. Ausdruck an. Mühselige Fleißarbeit. Der Aufwand stand in keinem Verhältnis zu den gewonnenen Einsichten in den Gehalt der Texte. Allein der Zusammenhang zwischen Dichtung und Musik ließ sie aufmerken. Ihr schien es, als seien die Zeitalter der Götter und großen Visionen in der Vergangenheit versunken. Auf lange Sicht sah sie keine erneute Heraufkunft von dergleichen.
In Gedanken befasst sie sich mit ihrem Beitrag zur Kölner Ausstellung Metamorphose, die als eine der 10 Ausstellungen den Epochenwechsel von einem Jahrtausend zum nächsten begleitete. Sie sammelte erstmal Wörter zum Wandel, zum Werden und Vergehen, zur Transformation oder Veränderung. Wie war der Übergang von einer Zeit in eine neue? Bruchartig, sprunghaft, wechselhaft, übergangslos? Vielleicht sollte sie eine Liste von Jahreszahlen, die einscheidende Ereignis in der Geschichte darstellten, als Hintergrundmaterial erstellen? Sie fand die Aufgabenstellung reizvoll, jedenfalls beschäftigte es sie unablässig untergründig. Hier und da liefen ihr Zitate über den Weg.
Sie sah sich am Ufer, grüßend in das Offene hinein, das Kommende. Und sie spürte in dieser Haltung eine große Kraft, so als sei sie gewappnet für das Unbekannte, das auf sie zukam. Dabei wußte sie doch, die neue Zeit war bereits angebrochen, das Zeitalter der elektronischen Information und das Zeitalter der Massaker und Massenfluchten.
Nils Röller lebte und arbeitete mittlerweile am Medieninstitut in Köln. sie hatte mit ihm über e-mail Kontakt. die Tausend Plateaus-Lektüregruppe war inzwischen auf vier Personen geschrumpft, so daß sich die Frage stellte, wie lange sie in dieser Form Bestand haben würde. sie hatte unabhängig davon ein Plattenlabel mit dem Namen Mille Plateux ausfindig gemacht und sich von den Machern das gesamte Programm auf CD schicken lassen. Eine eher aalglatte Techno Trance Music, die sich hier und da mit Deleuze-Zitaten schmückte. Nichts Aufregendes. Dagegen spielt sie die neugekaufte CD von Shelley Hirsch fast täglich. Ihr gefiel die Kraft und Ironie ihrer Stimme.
Mittlerweile war der 5. September. Die Urlauber waren alle zurückgekehrt, auch die letzten Postkarte waren eingetroffen, die Straßen wieder verstopft, feuchte Kühle am Morgen und Abend. Wo war die Zeit geblieben? Der ganze letzte Monat? Sie hatte wieder einen Band fertiggestellt, Tonbandmaterial für eine CD zusammengestellt, aus 20 Jahren Buchproduktion 20 Minuten Zitate herausgesucht, einen Komponisten und einen Schauspieler für die Weiterverarbeitung gewonnen, die neuen Coverentwürfe in Angriff genommen. Nach zwei Tagen Faulenzen hatte sie nun die Überarbeitung abgeschüttelt. Sie hatte einen Abend mit Jus im Ex+Pop verbracht, und an einem weiteren hatten sie zusammen einen neuen Veranstaltungsort an der Spree besucht.
Damit war der Sommerabschluß besiegelt. Jus war abgereist und sie tüftelte an den Plänen fürs nächste Jahr. sie ging den Fragen der Ornamentik nach. Und fragte sich, mit welchen Mitteln sie ein farbiges Rauten-Muster am besten herstellen könnte. Sie war in ihrem Element und es gab so viel zu tun. Sie musste nur die Hauptziele fest im Auge behalten, durfte sich nicht verzetteln. Technikfront, Lebensstil, Programm, Finanzen, Archiv.
Es war ein verregneter trüber Sonnabendnachmittag Mitte September. Die Ernte war soweit eingefahren, die Bücher gedruckt, der Prospekt gemacht, nur noch die Auslieferung der Herbstproduktion fehlte. Sie hatte sich seit 2 Tagen vom Verlag frei gemacht, um langgehegten Wünschen und Neugierden nachzugehen: ein paar Stoffmuster hier, ein paar Zitate da. Schon war sie in der blühenden Welt der Ornamentik aus Japan, China, Indien. Ein Labyrinth, in dem sie sich mit Freuden länger aufhalten würde. Immerhin waren daraus ein paar neue Cover-Entwürfe hervorgegangen. ein paar Tage in der Welt der Bibliotheken mit ihren verschollenen Büchern, Erstausgaben, griechischen, hebräischen und lateinischen Sprachen, mit dem Reichtum des Wissens von Magiern, Malern, Alchemisten, Gläubigen, Besessenen, Dichtern, Wortgewaltigen. Und über all den Wissbegierigen, Studierenden, Lesern schwebte die Stille in den großen Hallen der Bibliothek. Hier und da unterbrochen von einem Flüstern. Selbst die Schritte dämpften Läufer. Strahlend brachte sie an diesem Tag zwei Zitate wie errungene Trophäen mit nach Haus, die sie schnell und gewissenhaft der bevorstehenden Übersetzung über Farben einverleibte. Die wenigen Zeilen stammten aus dem magischen Werk des Cornelius von Agrippa und betrafen die die Farben der Planeten. Ein paar andere Zeilen stammten von Sappho, wie sie die Farben der Haare und Kränze besang. Un in der Begeisterung ihres Tuns sprang ein kleiner Funke über in ihre Seele, so daß sie spürte, wie die Lichter der Augen angezündet wurden.
In ein paar Tagen hatte sie sich einiges an Wissen angeeignet: Marco Polo, T.S. Eliot, Alberti, Leonardo, Aristoteles, Ficino, Sappho, Oscar Wilde, Agrippa, Joseph Albers, Ad Reinhardt.
Jus hatte nebenbei erwähnt, daß er während seiner Abwesenheit keinen Alkohol trinken würde. Sie hatte sich im Stillen dasgleiche vorgenommen. Und siehe da: Seit gut 14 Tagen hielt sie die Spannung, die über seine Abwesenheit hinaus dem stillen Einvernehmen die Treue hielt. Seinen guten Einfluss spürte sie als Lebenskraft in sich wachsen.
Am Sonntag besuchte sie eine Matinee-Vorstellung im Haus der Kulturen der Welt mit traditionell japanischen Filmen. Sie hatte sich zu diesem Kino-Besuch ihre Haartracht mit einem Stäbchen zusammengehalten und ein schwarzes japanisches Gewand aus den 20er Jahren angezogen, das noch das Familienwappen der Shoguns trug. Es ging für sie dabei ja nur darum, zu einer Geisteshaltung zu finden, die der eigenen entsprach. Es war ein asketisches Modell der Ausgeglichenheit, da bis hin zur Ernährung seine Auswirkungen zeigte. Sie glaubte, einen Aufführungsort für den japanischen Tänzer gefunden zu haben, der ihr vergangenen Jahres den Zugang zu den Tempeln verschafft hatte. Im Spiegel versuchte sie sich in Körperhaltungen und Posen, die alte Bedeutungen noch beseelten. Sie war doch in ein Werden eingetaucht, das vor dem grünen Tee nicht halt machte. Sie schwebte vondannen und grüßte von Ferne herüber zum Abschied. Gefolgt von einem großen langen Durchatmen.
Es ging um das Herausarbeiten von Formen, wollte sie die Innerlichkeit verlassen. Sie träumte von machbaren Möglichkeiten. Und das beglückte sie.
Immer, wenn sie die Augen aufmachte, verletzte sie, was sie sah, oder es machte ihr Angst, weil sie nicht begriff, was sie sah. Sie dachte noch immer nach über den Ausspruch, den ihr Hanns, der Schauspieler, gesagt hatte: strukturelle Blindheit. Es wandelte sich so vieles auf einmal, daß sie davon erfaßt wurde wie von einem Sturm, der sie mitriß.
Mit ihrem Modem war sie immer noch nicht weitergekommen. Irgendeine Sperre, etwas unheimliches, das sie hinderte, in deinem wichtigen Neuland weiterzukommen. Dafür war die Herbstproduktion fertig, der Prospekt verschickt. Zeit für Neuland und neue Unternehmungen. Schon zwei, drei Tage in der Bibliothek kamen ihr vor wie eine Weltreise in unbekannte, vergessene Zeiten. Sie war ja so bescheiden. Ein paar Stunden Freilauf – und sie hatte wieder Energie und Freude getankt. Nur die zur Zeit geringen Umsätze machten ihr Sorgen.
Es schien ihre, als sei wieder ein kleiner unmerklicher Zeitsprung vonstatten gegangen mit Beginn Montag, dem 26. September 1994. Sie hatte an diesem Tag sich von ihrer “psychischen Betreuung” bei ihrer Ärztin verabschiedet, nachdem sie im Frühjahr 1989 in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden war. Am selben Tag hatte eine französische Zeitung, die seit 1970 existierte, ihr neues Layout präsentiert, um der veränderten Zeit Rechnung zu tragen. Seit diesem Tag gab es auch einen künstlerischen Plakatentwurf von ihr zum erstmal in den internationalen elektronischen Netzen. Sogar die zwei Supermärkte, bei denen sie normalerweise einkaufte, hatte ihre Regale umgeräumt, aber dies sei nur am Rand erwähnt. Seit knapp einer Woche waren sämtliche elektronischen Geldautomaten der Post in der Stadt ausgefallen. Ein harter Fakt in inflationären Zeiten.
Sie selbst war ruhig und aufgeräumt. Die Herbstproduktion war geerntet. Nun galt es, sich die Verbreitung zu kümmern. Die Außenaktivitäten des Verlages ließen zu wünschen übrig. Auch die technischen Fortschritte gingen zu langsam. Sie brauchte Hilfestellung von usern.
Jus war zurückgekehrt, aber bei ihrem Zusammentreffen war sie äußerst zurückhaltend bis ärgerlich. Er hatte ihr ein nicht-funktionierendes Videogerät hinterlassen, und seine sonstigen Hilfsdienste ließen zu wünschen übrig. Zum ersten Mal war ihr klar, daß seine Kontakte rein funktional ausgerichtet waren und alles Darüberhinausgehende nur ein unvermeidliches Deckmäntelchen darstellte. Sie ließ ihn mal eine Weile auflaufen.
Die Kisten für den Stand der Buchmesse waren gepackt, die zwei Tage “Leerzeit” nutzte sie für die ersten Schritte im internationalen Computernetz. Was für eine Welt. Im Nu war man in anderen Ländern eingeklinkt und konnte – sie konnte noch kaum – sich alle möglichen Dateien ins Haus holen. Von Atemtherapie über Reisebüros bis Sportnachrichten war alles vorhanden. Sie kämpfte mit den mangelnden Englischkenntnissen und mit der Programmsprache bzw. den unterschiedlichsten Befehlslisten. Immerhin hatte sie ihr Plakat, das Künstlerfreunde im Wiener Internet angebracht hatten, angeschaut und dadurch die ersten Schritte in die diversesten Unterverzeichnisse gelernt. Nun war sie angefressen und brauchte Nachhilfe. Dadurch suchte sie wieder zu den verschiedensten Personen Kontakt, was sie seit Jahren nicht gemacht hatte. Immerhin, ein kleiner Schritt.
Nils rief aus Köln an, er wollte bei seinem Berlin-Besuch eine extra-Lektüre-Sitzung statt eines ungerichteten Kneipenbesuchs. Theoriebedarf statt Amusement. Straighte Generation. Aber irgendwie freute es sie, es entsprach ihrem Lebensapproach.
Sie glaubte, das JusKapitel sei abgeschlossen. seine Anziehungskraft wirkte nicht mehr. Vielleicht weil er derselbe geblieben war und sie sich verändert hatte. Sie hatten sich bei einer Vernissage getroffen und ganz natürlich hatte sie sich in seine Nähe begeben. In einem Reigen wechselten die Figuren umeinander, die einen Freunde kamen, die anderen gingen, ab sie ließ ihn unangesprochen im Raum stehen. Und ein Angebot für einen weiteren Programmpunkt des Abends ließ sie unentschieden im Raum stehen, bis er nach längerer Zeit davonfuhr ohne Anschluß. Sie fachsimpelte mit Folge eine Weile, dann sprach sie mit Hannes über Meister Eckhart und seine Stilistik, der Freundin von Thomas [Schulz] teilte sie mit, daß sie zu seiner Vernissage nicht in Berlin sei, als Nana kam, versäumte sie es wegen des Vorworts für den SchliemannBand sie anzusprechen, mit Thomas Lange schäkerte sie eine Weile, Eva-Maria [Schön] teilte sie mit, daß sie enttäuscht sei, daß sie sich wiederholte mit ihrem angekündigten KunstlerVortrag.
Und irgendwann war ihr kalt in dem Hof, in dem diese Kurzgespräche stattfanden und sie fuhr heimwärts. Ihren Compagnon nahm sie mit wie jemandem, dem es nicht gut ging.
Es war kalt geworden, und sie hatte sich noch nicht darauf eingestellt. Zwar hatte sie dieses Jahr zum ersten Mal wieder im Rhythmus der Jahreszeiten gelebt, sie war rechtzeitig im Frühjahr aus der wärmenden, schützenden Verpackung herausgekommen, im Sommer war sie gediehen, gewachsen, hatte sich zur Decke gestreckt und sich entpuppt, nun im Herbst … er war angebrochen. Wie würde er sein?
Täglich trafen Briefe für sie persönlich ein. Neue Freunde zeigten erstes Echo, alte Freunde erwiesen sich als treu und zuverlässig, in der Mittellage der Bekanntschaften entspann sich ein Beziehungsgeflecht, dessen Ausrichtung noch nicht auszumachen war. Die Ernte ihrer ersten Versuche, sich der Welt der Menschen zu öffnen.
Nach dem Zusammenbruch aller Kontakte hatte sie zuerst die Steine entdeckt als etwas, zu dem sie eine Nähe aufbauen konnte, dann war ein zartes Verhältnis zu den Pflanzen gewachsen und nun, nun endlich scheute sie sich nicht mehr, der Fremdheit des Menschen ins Auge zu blicken. Es war ja nicht eigentlich das Auge, was sie scheute, es war die Vielfalt des Gestus, des Äußeren, worauf sie nicht zu antworten wußte. Sie war immerhin entschlossen, sich dem Unbekannten zu stellen.
Dieser Jahresring bekam zunehmend große Lücken und Zeitunterbrechungen. Ihr wuchsen die Dinge über den Kopf. Und sie war wieder an dem Punkt, wo sie in Wahn verfiel. Sie mußte dringend eine neue Perspektive finden.
Das Jahr ging zur Neige. Die Koffer für die Reise nach Indonesien waren fast fertig gepackt, aber der Jahresring wollte sich nicht zur Vollendung runden. Der Antrieb reichte immer nur zu Anläufen, Neuanfängen, Versuchen, aber die Kraft zur Vollendung stand offenbar auf einem anderen Blatt. Große Lücken des Schweigens füllten die letzten Wochen, Monate. Sicherlich waren schon 2 Monate schweigend verbracht. Zeiten, in denen der Wahn von ihr Besitz ergriffen hatte und sie zur passiv leidenden, wortlosen verstummten Existenz degradiert war. Sie wußte nicht, welcher Sog sie hineingezogen hatte, welche Macht, gegen die sie sich vergeblich stemmte. Sicherlich all die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte, die nun auf sie niederdrückten als eine Schuld, die nicht zu begleich war und die sie zu zahlen hatte, wie auch immer.
In der Krise hatte sie zu rauchen aufgehört.
Der morgendliche Spaziergang durch den Kleistpark war ein neuer Weg. Und das Gartenbauamt hatte einen neuen Baum gepflanzt, den sie täglich als ihr persönliches Denkmal betrachtete.
Die Redaktion des Indien-Buches von Jean Grenier gab ihr die Sprache für unklare Eindrücke, Gedanken. Eine Geisteshaltung, eine Ausrichtung des Geistes. Sie freute sich auf das Erscheinen dieses Buches und arbeitete gerne daran. Die ersten 20 Minuten für die JUBI-CD lagen auch bereits vor, und an manchen Stellen mußte sie immer wieder Tränen lachen. Über diese riesigen Schränke, die es zu verschieben galt, sobald Fitzgerald überhaupt einmal die Anstrengung unternahm nachzudenken. Kuhn und Zischler hatten diese Sätze köstlich zu arrangieren gewußt.
In Gedanken sortierte sie ihren Alltag im Hinblick auf neue berufliche Aufgaben, um die sie sich bewarb. Mit dieser offenen Perspektive verließ sie das alte Jahr, reiste ins neue. Leinen los und weg …