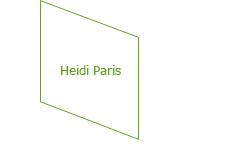René Magritte: Zwei Bilder
Heiner Müller: Vom Ende der Eroberungen
Pierre Klossowski: Einladung zur Gastfreundschaft
Sigurd Wendland: Bildbeschreibung
Anne Duden: Übergang
Penthesilea: eine Nachempfindung
Mike Hentz: Das Biene-Werden des M. H.
Eva Gagel: Leserbrief
Maurice Blanchot: Schreiben als Weg unablässiger Annäherung
Vito Acconci: Der Raumkünstler
Ingeborg Lüscher: Die Angst des Ikarus …
Brandung (Ausstellung)
Francesco Clemente: Meine Eltern
- Home
- Aktuell
- Aufsätze
- Brille Foucaults
- Wunschmaschinen
- Im Garten …
- Über M. Blanchot
- Zwischen Kunst und

Ellen Mund: zur Person
Ellen Mund war eine kleine unauffällige Person. Diejenigen, die sie kannten, fanden als Eigenschaft für Ellen Mund das Beiwort ’nett‘. Genausogut hätten sie sagen können ‚konturlos‘ oder ‚profillos‘, es wäre treffender gewesen. Sie kannte nicht viele und die sie kannte, kannte sie nur flüchtig. Wenn Ellen Mund auf der Straße zu sehen war, hörte man sie singen. Einfach und schlicht war ihr bisheriges Leben ohne herausragende Ereignisse dahingegangen. Keine Reisen, keine größeren Unternehmungen hatten sie herausgeführt aus ihrem Stubendasein. Ein stilles genügsames Wesen, grundlos vergnügt.
Alleinstehend, kinderlos, besaß sie nicht einmal einen Hund oder irgend ein Haustier, dem sie sich hätte anvertrauen können. Aber was hätte sie ihnen auch anvertrauen sollen? Gab es irgendetwas nennenswertes? Eigentlich mußte sie das verneinen, und doch verspürte sie von Zeit zu Zeit das Verlangen sich zu äußern. Da hatte sie sich in einer ihrer vergnüglichen Launen beim Schreibwarenhändler ein schönen Schreibheft gekauft. Die glatten weißen Seiten hatte sie mehrmals gestreichelt, bevor sie ihren Füllfederhalter aus der Schulzeit darübergleiten ließ.
Sie war in Sonntagsstimmung und legte ihre beste Schönschrift auf die Blätter. Verliebt in ihre Schrift füllte sie Seite um Seite. Sie schwebte dahin, und als ihre Feder ins Stocken geriet, da war das Heft schon beinahe vollgeschrieben. Stolz blätterte sie die tadellosen Seiten durch und legte sich schlafen. Sie träumte von wundervollen Wörtern und Sätzen. Sie liebte den Klang der Vokale und den Fluß der Rede.
René Magritte: zwei Bilder
Die Grenzen des Sommers
Aussicht in Fensterrahmen gespannt. Eine Aussicht auf Formen von Wolken und festkantige zusammengepreßte Blöcke. Aussicht auf eine Berglandschaft in der Tiefe, in der Ferne, aus deren versteinerter Vorzeit uns die Statue, die Kunstgeschichte aus Stein entgegenkommt. Diese gradlinig verstümrnelte Statue, behauen nach dem Schönheitsmaß der Gegenwart, ruht durch ihr eigenes Gewicht auf dem ewigen Rahmen für Geschichte und Kunst. Sie zeigt die natürlichen Formen einer Frau. Ihr klar erkennbares Geschlechtsmerkmal, die Brust, ist nackt und ihre Gürtellinie deckt sich mit der der Landschaft, so als wollte sie sagen: die Landschaft hat weibliche Formen und was sie hinabführt in die Tiefe ihres Geschlechts, das deckt sie mit dem Schleier grauer Vorzeit zu, den Steinwüsten, aus denen sie als Gestalt hervortrat, sie, kopfloses Geschlecht, deren Gedanken voll heil leichten Wolken durchzogen werden, formbar,veränderbar gegenüber den starr festen ideologischen Blöcken,deren nackte Rationalität sehr gradlinig wie eine tabula rasa sie enthauptete.
Die Erinnerung
Gegenwärtig hat die Verletzung stattgefunden, sie ist lebendig aufgezeichnet auf dem versteinerten Haupt von einst, in deren Schatten ihre Schönheit vollkommen erwacht. Sie blickt hinab auf den Stein des Anstoßes an der Grenze zwischen Aussicht und Einsicht auf dem griechischen Theater. Diesseits die Aussicht auf das ewige Blau und Weiß des Meeres, des Himmels und der Steine, wo das Blut der verletzten Krieger theatralisch auf versteinerten Statuen gerinnt und wo der Lorbeer blaß nur huldigt. Im Roten Schatten des Theatervorhangs erwacht lebendig die Erinnerung, eröffnet sich das Auge der Einsicht, daß der Sturz und die Verletzung noch vor ihr liegen. In der Erinnerung werden sie erst stattfinden, die Verletzungen von einst.
Heiner Müller: vom Ende der Eroberungen
Heiner Müllers Quartett nach Laclos‘ Gefährliche Liebschaften
Laclos, Schüler des Festungsbauers Vauban, lebte in der Umbruchphase der Kriegskunst, als die Schlachtordnung abgelöst wurde durch die Geschwindigkeit. Heute ist nicht nur der Angreifer schneller geworden, sondern die Ziele auch beweglicher. Diesem Faktum trägt Müller in Quartett Rechnung durch den Wechsel der Figuren.
Die vier Personen, die eigentlich nur zwei Personen sind, letztlich aber nur eine, die zerstückelt, vervielfältigt ist. Sie alle kämpfen den Geschlechterkampf. Sie kämpfen um Bastionen wie um Festungen: die Burgen der Selbstbehauptung sind aber schon längst erstürmt, sind unterlaufen durch die List der Vertauschung von Namen und Figuren. Die Eroberungen, die im Krieg wie in der Liebe, dem Geschäft, sich bewusst als Fortschritt verstehen gegenüber romantischer Gefühlsduselei, sind längst vom Zahn der Zeit in Affentempo überrannt. Die Festungsmauern der Abgrenzung oder Eingrenzung, die mit Leidenschaft genommen werden wollen, sind längst pervertiert, subvertiert, überholt. Von wem? Wodurch? Wie? Die statischen Positionen, hier bin ich und da der andere, können nur verlassen werden, wenn ich aus ‚ich‘ aussteigt, aus der Haut fährt, ’sich selbst‘ verdoppelt, diese ewige reflexive Zweiheit mit sich verdoppelt.
Verdoppeln heißt französisch dédoubler= entkoppeln, überholen. Nur wer sich selbst überholt, ist dergestalt für den Anderen kein Gegenüber mehr, auch keine Zielscheibe für Angriffe mehr, kann sich dem anderen beigesellen, sich einschiffen mit, auf die Schiene abflippen, und ab geht die Post. So nur kann Liebe entfesselt, rasend sein. Kein Hindernis weit und breit. Heißer Wüstensand, pfeilschneller Reiter.
Mit Quartett hat sich Müller auf vorgeschobenen Posten katapultiert.
Der flotte Dreier ist demgegenüber abgelutscht, hat ausgedient, die Dialektik im Kampf um Anerkennung auf Leben und Tod mit ihm, mit ihr. Da, wo der Angreifer hinzielt, ist die Figur schon längst nicht mehr. Der Angriff geht ins Leere oder an die eigene Adresse, und um das Eigentor zu vermeiden, muß der Angreifer sich selbst ausweichen. Das gibt dem Stück Dampf, Tempo. Mit dieser Kriegslist trickst sich Heiner Müller ebenfalls aus: Das Drama hat endgültig ausgedient, wenn keine Figuren mehr zugrunde gehen ‑ sind sie doch immer schon anderswo.
Dem häufigen und schnellen Wechsel, Wandel und Übergang der Figuren von einer Rolle, Identität, Person in die andere, bieten sich die Filmtechniken cut‑up und Überblendung als Medium viel eher an. Gattungen, ob als Tragödie oder Komödie, spielen dabei keine Rolle mehr. In die Sprache der Liebeskunst übersetzt hieße das: Geschlechter, ob als Mann oder Frau, spielen dabei keine Rolle mehr. Wenn Geschlechter, dann n Geschlechter.
Pierre Klossowski: Einladung zur Gastfreundschaft
Eine Ausstellungsinszenierung
Im gleichen Hause vermag dennoch nur derjenige als Gast empfangen werden, der diese Geste der einladenden Hand, die lockt und verführt, nicht als Aufforderung zur Besitzergreifung versteht. Im gleichen Haus vermag nur derjenige die Hand auszustrecken, der die Gesetze des Hauses kennt und zu zelebrieren weiß. Und trotz dieses Unterschieds dieser beiden, darf nie klar werden, wer welche Rolle innehat, wer welche Rolle spielt. Ihr guter Geschmack gebietet es ihnen, ihr guter Geschmack ist ihre Natur, jede Vortäuschung nur eine irritierende Spielart, die das Gewöhnliche zitiert.
Die aristokratische Rasse, die sich zelebriert im Gesetz der Gastfreundschaft, die aristokratische Rasse, die sich zeugt in Inzucht, lnzest, in Gattenliebe. Diese Brut gebiert Ungeheuer, die Ungeheuer des Immergleichen, die ewige Wiederkehr, im toten Kreislauf blutleerer Adern, mitten im Wirbel der Ereignisse lebt sie fort im muffig schattigen Dunkel, in der alten Kulisse des Adels. Perverser Fortbestand im Zeitalter der Pornographie. lm Glanzlicht nackter Busen wirken verstaubte Spitzenhöschen und Mieder noch verfallener.
Das Unzeitgemäße des lnterieurs ist für die aufgeklärte Sexwelle der verächtliche Rest einer längst überwundenen Scham. Nur verschrobene Spinner beten diese Scham als Heiligtum an, als Kleinod, das den Weg zur Invitation weist, zur Invitation in die Gesetze der Gastfreundschaft.
Einmal gebannt, sind sie eingetreten in den Raum, den Klossowski für sie geschaffen hat. Wer wird außer ihnen und Klossowski noch da sein? Und wenn sie die einzigen sein sollten, welchen entscheidenden Schritt hätten sie dann gewagt, daß niemand folgen konnte? Und wenn viele da sein werden, welches Fest würde dann zelebriert?
Das Ereignis ist nicht Produkt des Zufalls. Eine Inszenierung müßte gefunden werden, das Ereignis eintreten zu lassen, eine Anordnung müßte gefunden werden, die einen Kreis in der Mitte lässt. Dort würde er dann stehen zu empfangen,von dort aus würde er die Mitwirkenden ankündigen, die Punks, Performer, all diejenigen, die von der Leere angezogen sind, all diejenigen, die von der Leere zeugen, von ihr sprechen.
Alle, die sich um ihn versammeln, in der Rundkulisse seiner Bilder, müßten so zu lebenden Bildern werden, zu Tableaus, die nach und nach die Rollen der dargestellten Personen von den Bildern übernehmen. Man könnte als normale Besucher verkleidete Schauspieler einschleusen, die den Initiationsakt übernehmen.
Klossowski würde ihren Bewegungen eine Handlung geben, er würde sie anleiten, sie aus ihren Rollen herauslocken, sie zum Ausbruch bewegen, zu orgiastischen Trance. Er würde ihre Hypnose mit seiner Eingebung leiten, er würde ihnen seine Werke zitieren, er würde ihnen mit seiner Stimme, seinen Sätzen bedeuten, in welchem Land, in welcher Zeit wir leben, wo er und sie sich zusammengefunden haben: als Zeitgenossen, als Besucher einer Ausstellung, als Gäste in seinem Haus.
Eine Person würde diesen Text im leeren Kreis verlesen, Besucher würden sich darum scharen, die Tür würde aufgehen. Klossowski würde eintreten, er würde den leeren Stuhl in der Mitte einnehmen, er würde alle aufs herzlichste zu dieser Ausstellung begrüßen, er würde sich freuen, unter ihnen zu sein, er würde ihnen dies und jenes von seinen Gedanken mitteilen. Er würde andere zitieren, die ähnlich dachten wie er, er würde einzelne deshalb ihnen gerne vorführen, er würde sich von seinem Stuhl erheben, er würde die Nebentür öffnen: Da würden sie dann stehen, die Punks auf voller Bühne, sie würden ihr Konzert beginnen, in den Pausen würden einzelne Performer, getarnt als normale Zuschauer langsam ihre Action beginnen. Sie würden ihre Rollen weiter und weiter übertreiben, bis die Punks nicht mehr spielen könnten.
Klossowski würde einschreiten und sagen, so geht das nicht, er würde provozieren, er würde seine Bilder als beweiskräftige Argumente anführen. Sie würden spielerisch, bereitwillig darauf eingehen, sie würden die Bilder spielen … und so fort, bis …

Sigurd Wendland: Bildbeschreibung
Zwei Seelen, wohnen, ach nein –
Zwei Jacken, ja, auf seiner Brust
Zwei Porträts in einem, ein Selbstporträt mit offenen Lippen, einarmig ohne Unterleib, und ohne Hintergedanken, gesehen auf einen Blick ohne Augen im Schaufensterglas, im Moment der Bewegung, zwischen Konsumangebot und Waffengeschäft, im fliegenden Wechsel zwischen Schachmatt und Russsisch Schach, das ABC des Paul Klee.
Soweit die Beschreibung dessen, was ich zu sehen gedenke. Beim ABC angelangt, beginnt das Bilderrätsel. Das ABC ist da, weißgestrichen, durchgestrichen, auf den farbigen Hintergrund aufgetragen, gemalt. Der Maler, stellt er die Frage oder weiß er die Antwort? Auf welche Frage ist das Bild
die Antwort? Wie im Traum ist die Darstellung des Rätsels Lösung. Es gibt keinen im Vorhinein fertigen Schlüssel, weder zum Bild noch zum Traum. Kein fertiger Gedankenraster paßt auf das Bild, auch gibt es kein Geheimnis, das gelüftet werden müßte, selbst wenn Analytiker, vornehmlich Psychoanalytiker, das praktisch glauben. Alles liegt offen zutage, ist dargestellt in diesem Bild.
Welches ‘alles’ bildet hier ein Bild? Folgen wir dem Bildaufbau in seinem Bewegungsablauf, dem Uhrzeigersinn beginnend links unten:
Da ist der Ausschnitt aus einer Todesanzeige, zum Ausschneiden, zum Aufbewahren, zum Ausfüllen (bei Bedarf jederzeit griffbereit. Im Falle des Eigenbedarfs bitte vorher ausfüllen, nachher ist es zu spät!). Der ToT kündigt sich täglich in der Zeitung an, namenlos für jedermann. Er verdankt seine Existenz einem Fotostudio, das im Labor die Licht- und Schattenseiten, das Schwarz und Weiß mit aller Härte des Kontrastes herausfiltert aus dem Leben, dem Frischecenter aus Fleisch und Eiern.
Dazu Hans‑Jürgen Syberberg in Solo:
Wenn Menschenfleisch eine Delikatesse wäre, käme das Angebot aus Amerika und Deutschland sicher in die Supermärkte, als Massenware, das billige Sonderangebot, die mindere Qualität, gemessen an Ernährung und Lebensstress. Die Sonderklasse für Feinkostläden käme sicher aus Griechenland oder den unterentwickelten Ländern, den bemitleideten.
Doch soweit sind wir noch nicht. Noch sind wir geneigt, die Annoncenseiten in ihrem Einerlei aus Kästchen und Karos als Schachbrett anzusehen. Die Linien werden Flächen, das Schwarz wird Braun. Ein Werden kündigt sich an, ein Gestaltwerden.
Die Buchstaben und Ziffern vergilben als Ideologien, der Kämpfer zieht seine Fighter.Montur an und lebt die Kontraste und Widersprüche im Kampf. Das strahlend-weiße Supermarkt T-Shirt verkocht in der Hitze des Gefechts in der Waschmaschine zu griesgrau. Und was der Spießer das als Dreck zu denunzieren vermeint, ist hier nur die Armut an Geschmack. Hier ist ein Ebenenwechsel angesagt. Was anfangs ein malender Anarchist war, wird ein anarchistischer Maler (hoffentlich!). Er zieht die bunte Weste des Malers an, da verliert sich das zweidimensionale Denken in Widersprüchen, ein neuer Schaffensraum tut sich auf, die dritte Dimension wird sichtbar. Mit den noch blassen Farben eines neubegonnenen noch schwächlichen Leben ist auch die Umwelt nuancierter geworden. In einem neuen Leben beginnen wir neu zu lernen, neu zu buchstabieren: A, B, C … die Patronenhülsen, das ‘Russisch Schach’, sie muten an wie Reminiszenzen aus der Vergangenheit oder härter gesagt: wie Reliquien eines Salon-Anarchisten. Für einen Maler und Anarchisten ist da die Sackgasse, wo er das UND zwischen Anarchist UND Maler nicht in seiner Person zu synthetisieren versteht, wo beide als äußerliche Addition nebeneinander stehen bleiben. Das sieht man auf dem Bild.
Zu hoffen bleibt, daß das weiße Loch in der Leinwand einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet.
Das Bild ist äußerst aktuell, es dokumentiert die politische Geschichte der letzten 10/15 Jahre. Der Ausgang ist wie immer offen: Revolte als Kunst oder Kunst als Revolte?
Das Bild mag einen anderen Titel tragen, auch mag der Maler andere Intentionen verfolgt haben. Dennoch: Das ist es, was ich sehe.
In: Die Aktion, Nr. 29, Hamburg: Nautilus 1984, S. 394-396. Mit freundlicher Genehmigung der Edition Nautilus.
Anne Duden: Übergang
Übergang meint nicht: Fußgänger-Überweg, keine Passage, auch keine Brücke über den Jordan. ‘Übergang’ in der Titelgeschichte des gleichnamigen Prosa-Sammelbandes der Anne Duden meint – lapidar wie er dasteht: ohne Artikel , Adjektiv, ohne Plural – “ein richtungsloses Übergehen in andere Zustände”, wie es im Waschzettel des Rotbuchverlages heißt.
Etwas ist geschehen, ein Vorfall, eine Begebenheit. Das Geschehnis ging plötzlich vonstatten, ohne Grund, ohne Vorzeichen. Der Vorfall war ein Überfall, der wegen seiner Gewalttätigkeit für die Boulevard-Presse eine reißerische Titelgeschichte abgegeben hätte.
Im vorliegenden Band von Anne Duden wird das Geschehene literarisch zu einer Geschichte verarbeitet mit dem vielsagenden Titel Übergang. Die Komposition des 144 Seiten-Bandes ist symmetrisch, von der Mitte zu den Rändern hin, vorwärts und rückwärts lesbar.
Im Zentrum also die Titelgeschichte. Gleichsam Brücke zwischen Vor- und Nachgeschichten, die allesamt das Hauptgeschehen stützen, indem sie immer wieder von dort ausgehen, dorthin zurückkehren. Die Anordnung der einzelnen Kurzgeschichten, Liebesgeschichten, Bildbeschreibungen und Ich-Erzählungen, wie sie da heißen Das Landhaus, Der Auftrag der Liebe, On Holiday, ist so angelegt, daß die längste Geschichte, Übergang, im Zentrum dazu geeignet ist, den Dualismus aufzubrechen, den Mechanismus von Ursache und Wirkung, davor/danach, Sinn und Zweck. Im Übergang kommt zur Deckung, was Anlaß der Rede ist und Schrift zur Folge hat: der Übergang vom Geschehen zur Geschichte.
Jemandem, der Autorin und Ich-Erzählerin, ist etwas zugestoßen, ein Unfall. Was da blindwütig zuschlug, war purer Zufall. Es hätte jede treffen können. Ohne Vorwarnung, ein Schock. Und dieses Mißgeschick wird zur leidvollen Schickung, zum Schicksal. Das Geschehene wollte gebannt, in Worte gefaßt werden, hatte es doch ein ganzes Leben markiert und gezeichnet. Am Anfang der Erzählung steht ein Bericht über den Ablauf des Geschehens, trocken und sachlich, eine vorschriftsmäßige Schilderung, wie sie etwa vor Gericht vorgetragen werden könnte. Doch was da nüchtern geschildert wird, bringt etwas Ungeheuerliches hervor, ein Schauder durchfährt einen. Die Ereignisse treffen wie der Blitz. Der Versuch einer Rekonstruktion dessen, “wie es gewesen ist”, hat etwas Unvollständiges, wenn nicht Vergebliches: Der Deformationsfaktor ist aus dem Ereignis nicht zu ermitteln.
Die Folge des Ereignisses, eine lange Krankengeschichte, während derer der zermalmtet Kiefer wochenlang geschient und geknebelt zum Gefängnis wird: kein Platz für einen Schrei. Dem Schrei des Schmerzes fehlt das Organ, ohne Mund kein Schrei der Verzweiflung. Im Übergang von der Krankheit zur Genesung werden die Spuren der Verletzung zunehmend unkörperlicher und, körperlich wiederhergestellt, bleibt die Seele voller Narben zurück. Was da im Zustand der Sprachlosigkeit in sich hineingefressen wurde, ein Zustand, wie er für Jungmädchen-Biographien allgemein gilt und in dieser Geschichte als Traumprotokoll, Erinnerungsfetzen und Tagebuchnotiz parallel eingeführt wird, wird hier im Zustand der Schrift als Kotzbrocken Stück für Stück wieder herausgewürgt.
Diese losgelöste Schreibe, Erstlingswerk einer Vierzigjährigen, wird gerade da am stärksten, wo sie im Außen keinen Halt findet. Der zähe Versuch, sich an die Ordnung der Dinge zu halten, gleitet immer wieder ab in Einbildungen, Delirien. Die klaren Konturen alltäglicher Begebenheiten im Bus, in der Wohnung, im Restaurant, sie lösen sich auf, schleimige Schlieren-Bilder tauchen empor. Das Cover des Bandes, eine Zeichnung van Goghs am Rande des Wahnsinns, setzt ein Zeichen für diese Sicht.
Doch will mir scheinen, ist es ein zu eindeutiges Zeichen. Denn diese Horror-Visionen inmitten aller Harmlosigkeit, diese schleichenden Übergänge und Verschiebungen zwischen der Instanz des Realen und der des Imaginären sollten nicht bloß Objekt psychologischer Forschung sein; sie könnten als “richtungsloses Übergehen in andere Zustände” gelesen werden, als produktives Werden, Literatur in statu nascendi.
Penthesilea: eine Nachempfindung
Sie ist der Riss in ihrer Brust, der liebt und tötet zugleich. Kein Amazonenstaat kann ihn befrieden, ewig wird er klaffen in ihrer Brust, im glühenden Feuer tötet sie den, den sie liebt. Sie lebt im ewigen Fluch ihrer Wiederkehr noch heute. Kein Kunstwerk kann sie heimholen, kein Tempel ihr Frieden schenken, nicht den Gott schenken, den sie ersehnt.
Kein Amazonenstaat lebt fort, wenn sie gestorben; lebt sie weiter, so nur der unerfüllten Hoffnung wegen. Jeder Tempel sei ihr nun recht, und nichts wird sie hindern, ihr Fest zu zelebrieren. Wer ihr huldigt, huldigt ihm.
Ach, ein grausames Wissen dies. Lieber träumten wir wonnig von Harmonie. Zerrissen der Schleier, trägt wer dieses Wissen fort, nimmt wer den grausamen Dolch zu töten, den sie liebt? Wer, frage ich, wer? Wer ergreift das Messer in heiligem Zorn, wer geht hin zu tun, was das Herz befiehlt, den Freier zu töten, um den sie wirbt?

Mike Hentz: Das Biene-Werden des M. H.
Zu einer Installationsperformance
Als Kind befragt, was sie denn einmal werden wolle, war ihre Antwort klar: Tänzerin. Seit kurzem weiß sie, man kann vieles werden: als Mann eine Frau, als Kafka ein Tier, als Beckett ein Stein.
Und was würde aus ihr? Nach schwarzen und grauen Jahren tauchte ein blasser Streifen auf, der Spur folgend, trat sie die Bahn aus, die sie werden sollte: ein intensives Gelb. Gelbe Socken, ein harmloser Anfang nur, dann das Schreibpapier gelb und schön, auch das Postauto kein Dorn im Auge mehr. Allmählich machte sie die Welt in gelber Farbe aus. Doch Yellow Magic wurde zur gelben Sucht, sie färbte ihre Seele ein. Seitdem ist die Rasse ihrer Wahl nicht weiß, nicht schwarz. Das Gelb bevölkert sie.
Anverwandlungen dieser Art verkehren die Welt. Nicht erwachsen geworden, nicht Frau geworden, um darin Halt zu finden als Stützkorsett oder Rüstung gegen feindliches Außen. Ein intensives Werden ist ein fortwährendes Auflösen in . Dinge sind nicht länger Gegenstand der Betrachtung, sie blicken zurück: Mit ihnen werden wir zu dem, als das sie uns anblicken.
Im offenen Außen, da blickt sie das Gelb an, leuchtet im Kino von der Leinwand, strahlt sie an. Gezeigt wird ein Video Tape der 49-stündigen Installationsperformance von Mike Hentz, der sich mit ca. 30 Tausend Bienen hat einschließen lassen, um zu werden wie diese. Ein Schmelzversuch, der gelungen ist, und dessen Anfang denkbar einfach und schlicht wie folgt lautet:
Nachdem ich in früheren Zeiten ziemlich konsequent mit Rot, Blau und Grün gearbeitet hatte, … habe ich die Bienen zum Anlaß genommen, mit Gelb zu arbeiten, der Boden gelb, die Haut, die Bienen etc. Gelb, die Farbe der Pest im Mittelalter und der Asozialen, der Eifersucht, aber auch des Goldes.Oder der Sonne …
Die Vorstellung, einen Bienenstock mit einer Verbindung nach Außen (das Medium Film/Video als Fenster nach draußen) in der Wohnung zu haben, wird, so absurd sie auch scheinen mag, sichtbar einleuchtend gemacht durch die Installation. Ein hoher Tisch, nur mit Leiter zu erreichen, bildet den Grundstock für die Menschenbienenwabe. Die abgedichteten, verdunkelten Fenster machen den Raum zum Bienenkorb. Das Auge der Kamera, die Einflugschneise, das Fenster.
Der nackte Oberkörper, öltriefend, mit gelbem Farbpigment verschmiert, lässt an Blütenstaub und Honig denken. Der Grundstoff der Arbeitsbiene ist auch der Grundstoff des Malerkünstlers: Honigproduktion und Farbherstellung bedürfen beide des Blütenstaubs. Das Bindemittel zwischen beiden ist keine Mimesis, auch steht nicht das eine als Metapher für das andere.
Das Wort, das diese ihre Verbindung nennt, heißt Wahlverwandtschaft.
Das Bienensummen in Stereo, für Menschenohren den Pegel etwas hochgedreht, lässt uns eintauchen in den subjektlosen klanteppich, wo sich Tonstreifen überlagern, sich ineinander verschieben und verweben. Und wir, eingesponnen mitten unter ihnen, Teil von ihnen, vergessen den Zeittakt nach Menschenmaß; eine Stunde, zehn Minuten gelten uns gleich. Das An- und Abschwellen, das Gleiten und Verschieben kennt keine Pause, keine Wiederholung, keine Dramatik.
Anklänge an Minimal Music wie bei Steve Reich, Phil Glass, doch kein einschläferndes SummSumm. Die Bienentöne stacheln an, treiben das Blut hoch, da plötzlich, im Moment der Gefahr, schießt sie den Stachel ab, sterbend tötet auch Kamikaze — und er Wurfpfeil trifft auf die gelb-schwarze Zielscheibe. Diese Wurfscheibe mit ihren gelb-schwarzen Ringen, wie sie die Bienen als Markierung tragen um den Rumpf, ihr Wurfgeschoß, ist geniales Requisit in der Bieneninstallation des Mike Hentz.
Da, wo Hentz den Wurfpfeil abschießt, ist er ganz Biene geworden, und da, wo er hart auftrifft, erhält die Installation ihre Signatur. Gipfel, Vollendung, Zielpunkt ineins. 30 Tausend Bienen – Mike Hentz einer von ihnen, unter ihnen, mit ihnen.
Welchen Platz der Künstler in ihrem Staat eingenommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis, man müßte Mike Hentz fragen, oder besser, die Bienen. Wichtiger als diese Frage scheint mir die Tatsache, daß die Verschmelzung gelungen ist und mit ihr die Installationsperformance.
Zu Ende das Video Tape, die Performance vorbei. Bleiben wird das Bienenvolk, dieser fliegende Staat. Weiter treibt, rennt und rast, wen kein Staat bindet. Rückhaltloses Werden, unterwegs zu neuen Formen, wird der Künstler Nomade, die Kunst staatenlos.
Mit zwei Jahren Abstand folgt sie, die Dame in Gelb, den Avanciertesten unter den Nomaden. Wie Marlene Dietrich in Morocco läuft sie am Ende in die Wüste dem Geliebten nach.
In leicht veränderter Form auch in: Minus Delta t et al.: Das Bangkok Projekt
Eva Gagel: Leserbrief 14.3.83
Liebe Eva,
ich habe Dein Selbstinterview (das AutorInnen-Iinterview solltest Du später einmal machen) in der taz gelesen. Es war für mich mutig, klug, erfahrungsträchtig. Über die Entfernungen hinweg nimm dies als meinen “Leserbrief”:
Mir scheint, es ist nicht der Abgrund zwischen Denken und Fühlen, worin Du Dich verstiegen hast, vielmehr hast Du Aussehen mit Aussicht verwechselt. Du hast versucht, mit Deinem Spiegelbild, so wie Dich die anderen sehen, identisch zu werden. Was aber in Dir steckt, das sieht man Dir nicht an. Was in einem steckt, ist ohnehin nur potentiell. Jedes Stück, das Du davon nach außen arbeitest, ist ein Fragment, erste Annäherung an das, was man nach dem Tode Werk nennt, diesen Haufen erbrochener Teile! Nur Mut. Deine künstlerische Arbeit könnte das Thema “Rausarbeiten” tragen; Berufsbilder, Berufsbezeichnungen sind dabei ohne Belang. Welche Manifestationen, welche Formen und Gestalten das Thema annimmt, dem dürfte Deine Sorge schon gelten und Deine Fragen sich widmen.
Auf die Frage: “Was Du denn machst?”, könnte die Antwort “Künstlerin” Dir gut stehen. Sie läßt Dir den größten Spielraum (nicht nur den zwischen Geistesblitz und Solarplexus). Die Frage, womit Du Dein Geld verdienst, wird anderswo entschieden. Auch ich habe den Stein der Weisen nicht gefunden.
Jedes Stück Arbeit, das nach aussen geht, begreife ich als schrittweise Annäherung, als partielle Antwort einer Frage, die sich niemals stellt oder die wir nur im Nachhinein aus dem Geschehenen und Gemachten versuchen herauszulesen. Es gibt nichts Ursprüngliches, immer nur Wirkungen.
Nochmal: Das, was Du bist, das sieht man Dir nicht an. Das, was Du aus Dir machst, das wirst Du sein. Ein Werden also, das, wenn die Sterne günstig stehen, vor dem Tod nicht haltmacht und mit dem Tod nicht endet.
Es wäre mir lieb, wenn Du von dem Gesagten meinen deutschen Ernst und philosophischen Tiefgang abziehen könntest. Auch ich möchte gern luftig leicht und lachend sagen können, was ich zu sagen habe. Es gelingt mir bislang nur selten, das Handwerk muß noch besser erlernt, die Waffen noch besser geschmiedet werden, damit die technê, List und Erfindungsgabe, das Medium der Kunst, voll zum Tragen kommt.
Gruß, Heidi
ein Jahr früher (1982) Korrespondenz, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Eva Gagel im Herbst 2011:
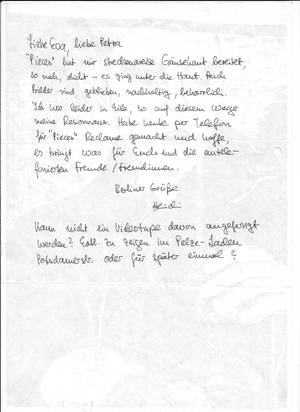
Vito Acconci: Der Raumkünstler
Wände davor und dahinter, darüber und dazwischen. Böden, Zwischendecken, doppelte Böden. Durchgänge in der Raumschräge machen Blicke um die Ecke möglich. Drehungen und Windungen durchkreuzen die Geometrie von Platten, Wänden, Flächen sowie deren Instrumentarien. Modulationen und Manipulationen des Lichts, die damit erzeugt werden, geben den Instrumentarien selbst etwas von ihrer Körperlichkeit zurück.
Was sieht man zuerst? Wände oder Durchgänge? Schwarz oder Weiß? Licht oder Schatten? In den Durchgängen macht das Licht die schwarzen Schatten der weißen Wände sichtbar. Tuchbahnen, die von der Decke hängen, stellen sich als Trennwände in den Weg. Tischplatten ragen zum Fenster heraus.
Wachsende Geschwindigkeit vernichtet den Raum, den sie durchmißt.
Durch Vito Acconci’s Räume geht man gemessenen Schrittes, neugierig und vorsichtig ob einer Welt, die man nicht kennt. Hier spukt es wieder ein wenig. Ihre Leere ist mit Gestalten aller Art bevölkert; das Böse ist ebenso anwesend wie das Schöne. Es sind Labyrinthe so ausweglos wie diese, aber offene Labyrinthe: bei so vielen Ausgängen führt keiner mehr hinaus. Außen ist innen, Durchgänge werden zu Wänden und Wände zu Durchgängen. Hier nun gibt es keinen Durchblick mehr. Es gibt Möglichkeiten des Agierens und der Wahrnehmung; keine Eindeutigkeit verhilft ihnen zur Wirklichkeit. Was ist wirklich? Zumindest läßt sie uns neue Wirklichkeiten entdecken.
Acconci installiert Räume in den Räumen, deren Form und Gestalt je nach Ort variieren. Zuweilen sind es Kapseln, die die letzten Überlebenden perfekt schützend einschließen, abschußbereit ins All der Science Fiction; zuweilen sind es Labyrinthe, die über Wendeltreppen vor den Abgrund führen; manchmal schlicht Höhlen oder Bäuche, selten offene Weiten. Immer Ausdruck eines gesellschaftlichen Kontextes: den etablierten Galerieraum zeigt Acconci mit Konferenztisch als Sprungbrett nach draußen; das alternative Loft im Künstlerviertel wird für ihn zur Bühne, unter der er sich verbirgt; das Museumsspektakel zum öffentlichen Briefkasten, wo jeder Besucher des Künstlers privateste Post lesen darf; das New Yorker Underground/Avantgarde-Zentrum Kitchens Garden wird zur Sex-Einsamkeits-peep-show mit Monitor und Selbstauslöser.
Die Luzerner Kunsthalle, die der amerikanische Artist als Schweizer 4-Sprachen-Verkeilung unter Spannung setzte, bildete die Abschlußarbeit einer Reihe von Rauminstallationen, die Acconci “cultural space pieces” nennt. Das war 1978. Leider habe ich erst jetzt, da meine Augen etwas offener für ungewohnt Neues geworden sind, davon erfahren. Der Katalog, den die Kunsthalle Luzern dazu herausbrachte, ist so gut, daß man auch ohne dagewesen zu sein, in die Räume eintreten und darin wandeln kann. Acconci’s genaue Beschreibungen der jeweiligen Produkte und Aktionen dienen nicht einfach als Verständnishilfe, sie sind Textgefüge, ebenso sinnlich und durchdacht wie offenbar alles, was er tut.
Im einleitenden Interview schildert Acconci seinen künstlerischen Werdegang. Von äußerlichen Fakten und Daten ist da wenig oder nur am Rande die Rede. So klar wie selten einer vermag Acconci den Ablauf seiner Produktionsweise über Jahre als Gedankengänge auszuweisen, die, wenn nötig, große Wandlungen vollziehen und deren rückhaltlos Offenheit für ein tatsächliches Werden von großem Mut zeugen. Angefangen bei Dichtungen, deren Hauptträger das weiße Blatt, seine Oberfläche war, betätigte sich Acconci dann als Performance-Künstler, für den die Raumfläche zum Träger seiner körperlichen Einschreibungen wurde. Am Ende dieser Phase stand die Erkenntnis, daß ein bloßes Selbstdarstellungstheater kein Gegenüber, kein Du zuläßt. Das Publikum wurde durch die Videokamera ersetzt, sie half, das Spiegelstadium der Selbstreflexion überwinden. Acconci verschwand daraufhin in den eigenen Kulissen oder unter der Bühne und gab den Raum frei für den Betrachter, der darin wandelnd, seinen Platz einnahm, sozusagen selbst zum Performer geworden.
Der Übergang vom Raum zum Ort war naheliegend, doch auch ein großer Sprung. War der Betrachter einmal in Acconci’s Räume einbezogen, lag nahe, auch den jeweiligen kulturellen Kontext, den Ort der Rauminstallation, die Galerien, Museen, Kulturzentren, Loft-Szenen einzubeziehen. Die Gedankengänge dieser Werkphase veranschaulichte Acconci mit den “cultural space pieces” in Luzern. Weit entfernt davon, den gängigen Klappmechanismus von Theorie und Praxis fortzuführen, gilt Acconci’s Bemühen in all seinem Tun der Schaffung einer umfassenden Sprache wie schon zu Beginn seiner Dichtungen.
Der Raum als Einschreibungsfläche, worin Dinge wörtlich zu nehmen sind, eröffnet neue Denkräume, die dem Unbewußten, dem Traum, den Wünschen verdammt nahekommen. Hoffen wir, daß Acconci sein Werden, seine Durchgänge, Übergänge, seine Reisen weiterhin so radikal offen halten kann für Ungewohntes und Ungedachtes. Seine Äußerungen auf den letzten Seiten des Luzerner Katalogs lassen dies vermuten.
Acconci heißt: einer Sache zugeneigt sein.
Ingeborg Lüscher: Die Angst des Ikarus
oder Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler
In Zeiten der Desorientierung dient die Reise als Strategie der Verschiebung … Paul Virilio
Außen wie innen, wechselnde Stationen, wechselnde Zustände, aneinandergereiht, Haltung auf Haltung folgend, in einer Bildersequenz, die durch den Schleier des Vergessens, leuchtende Farbzonen aufscheinen läßt wie Intensitätszonen auf der Karte eines Lebens, dessen wechselnde Stationen und wechselnde Zustände namenlos versunken wären, gäbe es nicht diesen Körper, in den sie eingeschrieben sind und der sie bewahrt als Kälte- und Wärmezonen, als Konzentrationen und Extensionen, Verkrampfungen und Ausstrahlungen, Licht-und Schattenseiten.
Von Handlungen zu Haltungen und von Haltungen zu Gesten lernen wir im großen Buch der Welt zu lesen. Eine Welt zu durchstreifen wir geboren sind auf einer Reise ohne Ziel. Sei es zum Denken oder Schauen, zum Nachdenken oder Hinausschauen: In jeder Richtung eröffnet sich eine Perspektive, sei es die Reise ins Innere oder die Reise im Außen, in jeder Hinsicht ermöglicht die Bilderfolge dem Betrachter Zugänge. Im Übergang, der Überfahrt, dem Werden zugeneigt, erkennen wir beim Umblättern in Bruchteilen das zarte Mädchengesicht, das dralle Lachen vom Lande, die Scham der Zaghaften, die gesichtslosen Ehehände, die affektierte Geile und die reservierte Beflissene, und am Ende SIE in ihrer Pracht und Fülle einem Rubens gleich. Goldrotes Haar am schweren Abendhimmel. Im Dämmer scheint Licht auf. Ein radikales Frauwerden auf der Klippe zwischen Fall und Sprung, vom Aschenbrödel zum Star empor.
Ingeborg Lüscher: Die Angst des Ikarus oder Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler.
Beschreibung einer Reiseerfahrung mit Wörtern, Gesten, Bildern, Farben. Vorstellung Darstellung und Ausstellung in einem.
[Arbeit mit 13 übermalten Polaroidfotos u. Texten; Aarau-Frankfurt am Main- Salzburg, Sauerländer 1982 ]
Brandung
Ausstellung von Peter Herbrich (Bildhauer), Thomas Lange (Maler) und R. v. d. Marwitz (Lyriker)
im Kutscherhaus Berlin, Mai 1983
Die Gemeinschaftsausstellung dreier Künste und der drei Künstler unter dem Thema Brandung ist nicht Resultat des Kunstmarktes, wo Künstler sich gemeinsam stark machen müssen; das Nebeneinander und Zusammen dieser Ausstellung ist Konzept. Die traditionelle Hierarchisierung zwischen Katalog-Abbildungen und Vorwort-Kommentar ist hier bewußt subvertiert. Der Text ist Bestandteil der Ausstellung, visualisiert per Vergrößerung auf Overhead-Folie als Textbild Schatten werfend. Die Inszenierung der Texte ist einnehmend, wenn nicht dominant gegenüber den anderen Medien Malerei und Bildhauerei. Die Stellen und Orte ihrer Hängung sachgemäß dort, wo der Zuschauer, en passant Worte aufschnappend, am Ende das Richtige liest.
Treppensteigend im Obergeschoß der bizarr anmutenden Ausstellungsräume, trägt der Text, der als erster ins Auge fällt, bezeichnenderweise den Titel “Dachgeschoß”, passend zum Raum sozusagen. Das “Passende”, was es auch sein mag, scheint Grundmotiv der Ausstellungsinszenierung.
Passend zum Thema Brandung, gab es zur Vernissage sauren und geräucherten Fisch. Passend dazu schillerte der Maler Thomas Lange mit seinem Anzug bücklingsfarben. Den Diener dazu hat er sich aber doch verkniffen. R. v. d. Marwitz, pomadisiert mit frischem Haarschnitt, wirkte dagegen eher aalglatt. Allein Herbrich, der Bildhauer, entpuppte sich im Verlauf des Abends als der Fisch, der auch schwimmen wollte, er ersoff vorab im Alkohol. Und obwohl die Ausstellungseröffnung buchstäblich ins Wasser fiel, blieb die Stimmung bei allen anwesenden heiter, man nahm den Regen als passend hin.
Die Bilder von Thomas Lange, die gezeigt wurden, waren sämtlich neue von 83, die frühesten unter ihnen wurden 80 in Angriff genommen. Die Titel der Bilder rundweg Meerestitel, Schilf, Woge und Welle, kennzeichnet sie der Rausch, der Drang, die Bewegungsenergie, die geronnen zu Bildern, ungeheure Wucht verraten. Sind sie wie der Berliner sagen würde “‘ne Wucht”? Eher kaum.
Da ist ein Zug, ein Sog, ein Drive, eine Motorik und Schnelligkeit, eine Energie in den Bildern, doch das Überschwappende und -schäumende wird eingedämmt durch harte Konturen. Besonders da, wo zart gleitende Farbübergänge zu sehen sind, werden sie direkt gebremst durch kontrastharte und breite schwarze Konturierungen, als könnte das Zarte, Anfang- und Ausgangspunkt, uferlos beängstigend werden.
So werden diese Partien eingedämmt und umgeben zum einen durch Konturen, zum anderen durch Farbelemente, die meist Ornamente sind, selten Thema. Innerhalb der konturierten Felder gewinnt die Farbe und mit ihr das Dargestellte Plastizität, Räumlichkeit, außerhalb wird sie platt zweidimensional Ornament, Schmuck, Zierrat. Thematische Symbiose ist nur im großen Bild in der Eingangshalle zu finden. Die Pinselbreite, die Besenbreite des Strichs, der sich quer über das Bild zieht, hat die Wellenbreite des Meeres, mit schäumend weißer Farbgischt im Bewegungsablauf verspritzt. Wellendynamisch und technisch perfekt.
Die Arbeiten des Bildhauers Peter Herbrich sind eher traditionell. Sie zeigen die in Stein erstarrte Welle, das vom Meer angeschwemmte Geäst, den Ankerhaken im Hafen, die Gullies aus der Stadt. Es ist der Erosbogen als Welle, der sich unvermeidlich aufdrängt. Schön die Zwittergestalt von Rohem und Poliertem.
Francesco Clemente Meine Eltern
Wie der Titel sagt, ist nicht nur ein Paar, Mann und Frau zu sehen, sondern auch dasjenige oder derjenige, der aus dieser Verbindung hervorgegangen ist. Auch ist der Entstehungsprozeß dieses überdimensionalen Kindwesens dargestellt. Im Zeugungsakt, recht ungewöhnlich, schiebt der Vater der Mutter den kleinen Finger ins Nasenloch. An der anderen Hand des Vaters fehlt der Mittelfinger. Diese Art Verbindung bleibt nicht folgenlos.
Es folgt eine Entbindung, entsprechend dem Zeugungsakt, eine Kopfgeburt. Wie eine Spruchblase bläht sich über dem Kopf des Elternpaares eine eiförmige Riesenblase auf, die den Bauchleib des Kindwesens bildet, angefüllt mit Totenschädeln. Der Kopf des Kindwesens, hervorgegangen aus den vielen Totenschädeln, ein leichenblasser Oberkopf mit rotgeschminkten Clownswangen und grünen Augen, etwas zwischen Embryo und Zombie. Das Olivgrün und Karminrot hervorgegangen aus Eigelb und Zartrosa des Elternpaares. Entsprechend die paar Hände und Paar Beine, die einen Olivgrün, die anderen Karminrot, mit Haken am Körper des Kindwesens angebracht.
Auch dies folgerichtige Darstellung der Sichtwelt des Kindes, für das die eigenen Gliedmaßen noch nicht dem Kopfzentrum,dem Bewegungszentrum unterstehen, die also noch nicht beherrscht werden.
Der Bildhintergrund im oberen Teil ein Teppich, das Ornamentale. Die unteren Zweidrittel in der Längsachse dreigeteilt, zeigen ein Rotbraun als Hintergrundfarbe, darauf musterartig Köpfe, während die linke Bildfläche grünbraun übermalt ist. Reste von Köpfen schimmern noch durch, von einer Kanone beschossen, bluttriefend die einen, die anderen roh, gesichtslos wie braune Eier oder Kanonenkugeln. Die Kriegsszene im Blickfeld des Vaters wird mit dem einen erhobenen Arm abgewehrt, während der andere sich zum Zeugungsakt erhoben nach hinten streckt.
Im Hintergrund, dem Hinterkopf der Mutter steht die Menge der verschiedenen Gesichter. Vater und Mutter, ihr gemeinsamer Gedanke, der Gedanke an das Kind, die Sorge um das Kind, die Leichenschädel.
Die Jahrgänge nach Kriegen sind bekanntermaßen geburtenstark. Der Farbkreis schließt sich. Vom Gelbocker des Vaters und dem Altrosa der Mutter gelanqt man in aufsteigender Linie zum Maigrün und Knallrot des Kindwesens und von dort in absteigender Linie zum Hintergrund in Weinrot und Olivgrün. Der Lebenskreis in Farben: ihr Erblühen ins Leuchtende, ihr Welken ins Dunkelbräunliche. Auch die Köpfe in ihrer Anordnung und Zahl scheinen einem Kreis zu folgen. Aus den zwei zusammengesteckten Köpfen entspringt ein Gedanke, eine Gedankenblase voller Totenschädel, der ein Embryokopf aufgeklebt ist, kahlköpfig wie die Totenschädel, blaß wie Leichen, im Hintergrund dann die Menge der Gesichter. Der Weg vom Erwachsenenalter über das Totenalter zum Kindalter.
Auch der Hintergrund eine Entwicklung: vom Teppichmuster zum figuralen Muster der Geschichte zur Zerstörung der Ordnung und der Farben durch den Krieg, dessen flächenartige Überlagerung. Ich, Francesco Clemente, das große Kind, entstanden aus der Paarung von Gelb und Rosa, beim Nasebohren, dem kleinen Finger des Vaters im Nasenloch der Mutter, entsprungen aus beider Gedanken, eine Gedankenblase voller Totenschädel, die Totgeburt einer Kopfgeburt.
Ich, Francesco Clemente, der Embryo als Zombie, habe noch Hand und Fuß, doch schon sind sie abgehackt, amputiert, paarweise an Fleischerhaken aufgehängt. Der Nährboden meiner Welt ist der naive Farbenreichtum geordneter Verhältnisse, am Boden krabbelnd fällt der erste Blick auf dis Teppichornament. Mit wachsendem Zeitalter taucht daraus die Menge der Gesichter auf, ein figurales Ornament der Masse, das einmal formiert, schon vom Krieg überlagert,bluttriefend im Chaos endet, die gesichtslose Form, vom Gras überwachsen,im Weißen der Zukunft endend. Wieder und wieder derselbe Kreislauf, wandert das Auge von den Eltern zum Kind,vom blaßgelb und rosa zum knallrot und maigrün, schließlich zum weinrot und olivgrün. Die Farben erblühen und altern, die Ordnung wird gleichgültige Menge,dann Wirre und zuletzt vom weißen der Fläche überdeckt.
Die Ordnung des Bildes, in allen Achsen durchdacht, teilt oben und unten, rechts und links durch das Mittelkreuz aus Kind und Eltern. Die Eltern bilden die untere Hälfte des Bildes, das Kind die obere Hälfte, der Hintergrund oben ein Drittel quer, symmetrisch dazu zweidrittel unten linksgeteilt in drei proportionale Drittel: rot eine Hälfte, grün zwei Drittel der anderen Hälfte, weiß das letzte Drittel der einen Hälfte.
Ich, Francesco Clemente, entstanden aus dem Akt des Krieges und dem Zeugungsakt, ich, ein Zwischenakt, ein Zombie als Embryo. Der Hintergrund meiner Kindheit, der Hintergrund meiner Leinwand, die Farbfülle und der Formenreichtum, liebevoll verwoben zum Wandteppich, Gegenstand alter Gebrauchskunst und Zierde, heute Vielfalt der Gesichte, Alter, Klassen und Rassen, die Weißen, die Schwarzen, die Gelben und Roten, in den Wirren des Krieges alle verletzt, bluttriefend, zerfetzt und zerstört, wird bleiben von meiner Leinwand das Weiße des Vergessens, das Weiß der ausdruckslosen Totenschädel, haarlos wie der Embryo, dessen Gliedmaßen, noch nicht im Gebrauch erlernt, schon amputiert am Fleischerhaken wie Ware feilgeboten werden.
Als Kind dieses Paares, das sie zu meinen Eltern macht, bin ich, Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit, ein Embryo und ein Zombie zugleich. Noch hebt der Vater den Arm schützend gegen die ersten Salven, die die Kanone namenlos abfeuert. Zugleich hebt er den Arm, ihr den kleinen Finger rücklings ins Loch der Nase zu schieben. Zwischen dem Ereignis des Krieges und dem Akt der Zeugung, ich, ein Zwischenakt, die Geburt der dritten Art. Das Gesicht der Masse ist aus allen Völkern und Rassen zusammengesetzt, aus Weißen, Schwarzen, Gelben und Roten, sehen sie alles, was auf sie zukommt, und offenen Auges wandern sie hinüber ins Lager des Krieges, das keinen Urheber mehr kennt. Und die Augen sind die ersten, die verletzt, blutend die Leinwand verschmieren, schon heute, die Leinwand von morgen. Wie in den Teppich die Geschichten von einst verwoben sind, malt der Maler von heute die Zukunft und den Teufel an die Wand: das Schicksal des eigenen Bildes vorwegnehmend, wird es blutverschmiert sein dann. Es gibt keinen Täter, alle sind Opfer, die Kanone geht von alleine los …
Ich, Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit, eine Kopfqeburt, eine Totgeburt. “Das Loch ist nicht mehr zwischen den Beinen, Mutter, es ist im Kopf”, kräht Clemente. “Wer hat mich zum Gespenst geboren?”, mich Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit, ich, ein Zwischenakt zwischen Krieg und Zeugung, Geburt der dritten Art, kein Ganzes mehr. Zwar Füße von Muttern und Hände von Vatern, hab ich zwar Hand und Fuß und bin doch ich kein Ganzes mehr, schon amputiert von Geburt an, bloßes Anhängsel, nichts taugend, Fremdkörper, keinem Zentrum unterstellt, keiner Macht gehorchend. Die Nabelschnur, Faden, an dem neues Leben hängt, ein Fleischerhaken jetzt, schon vor der Schlacht zerhackt, zerstückt.
Ich, kein Ganzes mehr, geschminkte Maske, ein Clown voll Traurigkeit, ein Albino voll Grauen, ein Kahlkopf, ausgeschnitten, angemalt und aufgeklebt auf einen Rumpf, diesen Sack voller Totenschädel, mein Leib eine Mördergrube, ein Massengrab.
Nach den Kriegen geburtenstarke Jahrgänge und vor dem Krieg? Leichenblässe, gespensterhafte Schwächlinge. Die Welt meiner Kindheit, der Teppich auf dem ich krabbelte und der in meinem Blickfeld lag, nah am Boden, buntes Muster, farbenfroh geordnet war die Weit. Nun ist der Wandteppich, die Leinwand, der Hintergrund überdeckt von den Wirren des Krieges, blutverschmiert und wird eingehen in das Weiße der Zukunft, die alles bedeckt, aus der nur schemenhaft noch Gesichte der Erinnerung aufscheinen, eines aber wird bleiben wie das meine, als eine Signatur dessen, der gesehen hat im vorhinein und gemalt hat die Bilder der Zukunft, zu sagen welcher Geist umgeht in unserer Zeit, ich, Francesco Clemente, der Seher und Maler, der an die Wände malt die Zukunft und sie beschwört, ich, Francesco Clemente, von dem bleiben wird dieses Bild der Zeit.
Hier kommt das Gespenst, das mich gemacht hat. (H. Müller, Hamletmaschine)
Das also war Dein Vater, das also war Deine Mutter (Deleuze/Guattari, Anti-Ödi)
Ich habe alle Söhne aus guter Familie kennengelernt. Ich habe niemals zu diesem Volke gehört; ich bin niemals ein Christ gewesen … Ja, meine Augen sind Eurem Lichte verschlossen. Ich bin ein Tier, ein Neger. (Rimbaud)
ICH, FRANCESCO CLEMENTE,
DIE GROSSE AUSGEBURT,
DIE DRITTE ART
Ich, Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit, eine Kopfgeburt, eine Totgeburt. “Das Loch ist nicht mehr zwischen den Beinen, Mamma, es ist im Kopf” krähte Clemente. “Wer hat mich zum Gespenst geboren”, mich, Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit? Ich, Zwischenakt zwischen Krieg und Zeugung, Geburt der dritten Art, bin ich kein Ganzes mehr. Zwar Füße von Muttern und Hände von Vatern, hab ich noch Hand und Fuß, und bin doch kein Ganzes mehr. Schon sind sie abgehackt, amputiert, bloßes Anhängsel, nichts taugend Fremdkörper, keine Zentrum unterstellt, keiner Macht gehorchend.
Nein, “Ödipus kenne ich nicht – denn die abgetrennten Stücke bleiben an allen Ecken des historisch-gesellschaftlichen Feldes, das einem Schlachtfeld und keiner bürgerlichen Theateraufführung gleicht, kleben.”
Ich, Francesco Clemente, Kind meiner Eltern und unserer Zeit, kein Ganzes mehr, geschminkte Maske, ein Clown voll Traurigkeit, ein Albino voller Grauen, ich ein Kahlkopf, ausgeschnitten, angemalt und aufgeklebt, ohne Hals für einen Schrei. Mein Rumpf, ein Sack voller Totenschädel, mein Leib eine Mördergrube, ein Massengrab. Ich, Francesco Clemente, große Ausgeburt, entstanden, als der kleine Finger des Vaters ins kleine Nasenloch der Mutter stieg, entstanden aus der Paarung von Rosa und Gelb, entsprungen aus beider Gedanken, als eine Gedankenblase voller Totenschädel; ich, Embryo und Zombie zugleich. Mein Nabel, der die Welt bedeutet, der Faden, an dem neues Leben hängt, ein Fleischerhaken jetzt.
“Ich will eine Maschine sein, zwei Arme zu greifen, zwei Beine zu gehen, kein Schmerz, kein Gedanke …”
selbst geheftet mit Collage-Einband
3 Exemplare